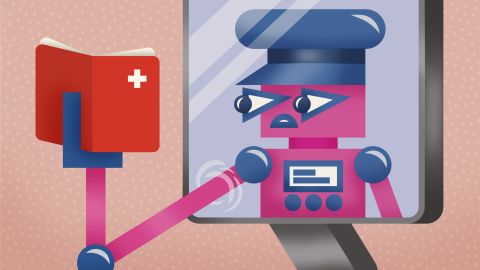Abstimmung vom 28. September: E-ID bringt Teilhabe
Kaum beleuchtet, trotzdem wahr: Die Einführung einer elektronischen Identität stärkt die direkte Demokratie.
Letzten Freitag fand in Bern eines der gut erprobten Rituale der direkten Demokratie statt: Kisten über Kisten mit Unterschriften wurden an die Bundeskanzlei überreicht, diesmal von den Kompass-Initiant:innen. Hier soll es nicht um den Inhalt dieser Initiative gehen, die das Ständemehr bei Abstimmungen über völkerrechtliche Verträge zur Regel erklären will. Sondern um die Frage, wie sie zustande gekommen ist.
Die Initiant:innen zeigen sich auf Anfrage transparent: 140 000 Unterschriften hätten sie insgesamt gesammelt. Sie setzten auf die Agentur Campaigneers, die 600 freiwillige Sammler:innen koordinierte. Diese steuerten 120 000 Un terschriften bei. Ein weiterer Auftrag ging an die Firma Sammelplatz, die gegen Entschädigung 20 000 Unterschriften sammelte und bei den Gemeinden beglaubigen liess. 115 000 gültige Unterschriften wurden am Ende eingereicht. Kurzum: Die Zuger Partners-Group-Milliardäre, die hinter der Initiative stehen, haben eine Maschine mit professionellen Kampagnenfirmen und freiwillig Engagierten konstruiert. Kostenpunkt gemäss Kampagnenbudget: eine Million Franken.
Die Initiative ist ein gutes Beispiel für den Zustand der direkten Demokratie. Eine Volksinitiative kann man sich noch nicht kaufen, ohne freiwilliges Engagement geht es nicht. Aber ohne Finanzstärke im Hintergrund eben auch nicht, zumindest im rechten Lager. Doch auch auf der linken Seite hört man immer mehr Klagen, wie anspruchsvoll es geworden sei, genügend Freiwillige zum Sammeln auf der Strasse zu finden. An dieser Stelle nun kommt die elektronische Identität (E-ID) ins Spiel, über die am 28. September abgestimmt wird.
Diese soll primär in jenen Fällen zur Anwendung kommen, wo vom Gesetz her eine Ausweispflicht besteht: bei Behördengängen, bei der Eröffnung eines Bankkontos oder beim Alkoholkauf. Darüber, ob bei gewissen Identitätsprüfungen eine Überidentifikation stattfinden könnte, also zu viele persönliche Daten bei privaten Firmen landen, wird zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen leidenschaftlich gestritten. Letztlich wird es eine sorgfältige Umsetzung brauchen, um allfälligen Missbrauch zu verhindern (siehe WOZ Nr. 34/25).
Kaum beleuchtet in der technischen Diskussion ist eine der wichtigsten politischen Anwendungsmöglichkeiten der E-ID. Nicht in ferner Zukunft, sondern möglichst bald sollen damit Unterschriften geleistet werden dürfen. Das Parlament will in der Herbstsession eine Rechtsgrundlage für einen Probebetrieb von E-Collecting schaffen. Die elektronische Unterschriftensammlung soll durch die E-ID ermöglicht werden. Das wäre allein schon vom Datenschutz her ein grosser Fortschritt: Statt wie heute durch Dutzende von Händen zu gehen, würden mit der E-ID die Namen der Unterzeichnenden bloss bei der Beglaubigung in den Gemeinden überprüft.
Vor allem könnte das E-Collecting die Demokratie fördern: Gerade für kleinere, finanzschwache Gruppierungen, Parteien und Verbände würde das Unterschriftensammeln vereinfacht. Und nicht zuletzt erlaubte es Menschen mit Beeinträchtigungen, sich stärker am politischen Prozess zu beteiligen, weshalb die E-ID auch vom Verband der Blinden und Sehbehinderten unterstützt wird.
Die Gegner:innen wenden ein, das E-Collecting könnte gehackt werden, was einen Vertrauensverlust zur Folge hätte. Jedoch kann die Unterschriftensammlung online weitaus sicherer ausgestaltet werden als auf der Strasse, wo kommerzielle Firmen zuletzt mit der systematischen Fälschung von Unterschriften auffielen. Überhaupt ist es eine Ironie der Geschichte, dass den E-ID-Gegner:innen eine elektronische Identität beim Sammeln für ihr Referendum durchaus geholfen hätte. 20 000 Unterschriften stammten von der linken Vereinigung Digitale Integrität, der Jungen SVP und der EDU, 20 000 Unterschriften von den «Freunden der Verfassung», weitere 15 000 von Nicolas Rimoldis Massvoll-Truppe. Ein eigenständig durch Links zustande gekommenes Referendum hätte den Pakt mit den Rechtsextremen verhindert – in der jüngeren Geschichte der Volksabstimmungen ein Tabubruch sondergleichen.