Steuergerechtigkeit : «Wir stehen am Wendepunkt»
In seinem neuen Buch plädiert Gabriel Zucman für eine Mindestabgabe für Superreiche. Warum er diese «taxe Zucman» einer Steuer auf Erbschaften vorzieht und welche Folgen die extreme Konzentration von Vermögen für die Demokratie hat, sagt der französische Starökonom im Interview.

WOZ: Gabriel Zucman, Ende November haben fast achtzig Prozent der Schweizer Stimmbürger:innen die Einführung einer Erbschaftssteuer abgelehnt. Wie erklären Sie sich das?
Gabriel Zucman: Steuern auf Erbschaften sind überall unpopulär, das deutliche Nein ist also keine Überraschung – auch wenn ich persönlich auf eine Annahme gehofft hatte. Die Leute haben das Gefühl, das Wichtigste, was sie für ihre Kinder tun können, sei, ihnen Geld zu hinterlassen. Vielleicht gilt dieser Grundsatz in der heutigen Welt mit ihrer wachsenden Ungleichheit umso mehr, obwohl Erbschaften die Ungleichheit ja erst recht zementieren. Hinzu kommt, dass bei der Erbschaftssteuer der Grossteil eines Vermögens zum Zeitpunkt des Todes abgeschöpft wird. Muss jemand auf einen Schlag enorme Steuerbeträge zahlen, kann das in gewissen Fällen tatsächlich zu Liquiditätsproblemen führen.
WOZ: Sie plädieren stattdessen für eine jährliche Mindeststeuer von zwei Prozent auf Vermögen von über hundert Millionen Euro: die «taxe Zucman», wie sie in Frankreich genannt wird. Welche Vorteile hätte sie?
Gabriel Zucman: Ich glaube, dass sie in einer Abstimmung deutlich mehr Chancen hätte als eine Steuer auf Erbschaften, was wir auch anhand von Meinungsumfragen auf der ganzen Welt sehen. Vor allem, weil damit eine grundlegende Ungerechtigkeit angegangen wird: dass die Superreichen im Verhältnis zu ihrem Einkommen viel weniger Steuern zahlen als der Rest der Bevölkerung.
Der Vordenker
Gabriel Zucman (39) gehört zu den führenden Expert:innen in Steuerfragen und Vermögensungleichheit. International bekannt wurde der französische Ökonom 2014 mit seiner Studie «Steueroasen. Wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird».
Zucman lehrt an den Universitäten Berkeley und Paris und leitet seit 2021 die Europäische Beobachtungsstelle zur Steuerpolitik. Diese Woche ist sein neustes Buch erschienen, in dem er eine Mindeststeuer für Superreiche vorstellt.
Gabriel Zucman: «Reichensteuer. Aber richtig!». Suhrkamp Verlag. Berlin 2026. 64 Seiten.
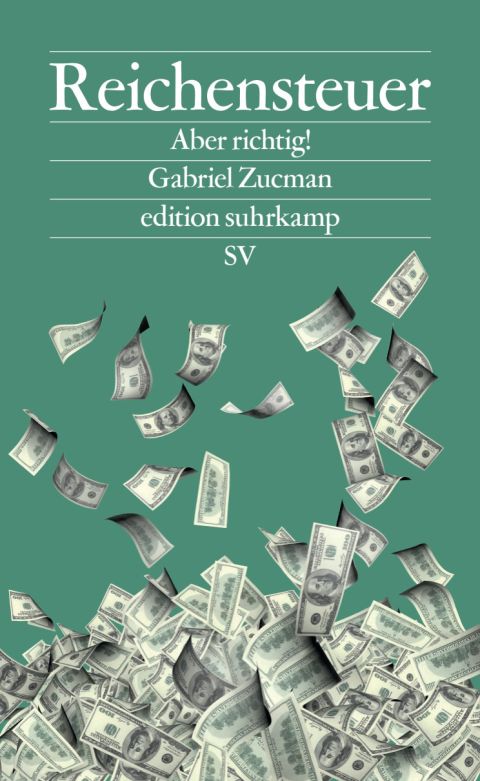
WOZ: Wie kommt das?
Gabriel Zucman: Für extrem Reiche ist es sehr einfach, ihr Vermögen so zu strukturieren, dass es kaum oder gar kein steuerpflichtiges Einkommen generiert. Vor einigen Jahren enthüllte das US-Investigativmedium «ProPublica» etwa, dass Leute wie Amazon-Gründer Jeff Bezos keine Einkommenssteuern zahlen, weil sie in der Steuererklärung nur sehr wenig Einkommen ausweisen. Einmal soll Bezos aufgrund seiner angeblichen Armut sogar Familienleistungen erhalten haben. Das ist nicht illegal, aber ein fundamentales Versagen der Einkommenssteuer. Rechnet man alle Steuern zusammen, zahlen Milliardäre im Verhältnis zum Einkommen nur halb so viel Steuern wie andere soziale Gruppen: ein grundlegender Verstoss gegen das geltende Prinzip der Gleichheit vor dem Steuergesetz.
WOZ: Wenn Sie von der Gleichheit vor dem Gesetz sprechen: Welche soziale Gruppe zahlt eigentlich wie viel Steuern?
Gabriel Zucman: In den reichen Ländern Westeuropas zahlen alle Bevölkerungsgruppen, die Arbeiter:innenklasse, die untere und obere Mittelschicht und die Reichen, etwa gleich hohe Abgaben, weil die Gesamtsteuerquote im Verhältnis zum BIP hoch ist. Das ist eine Entscheidung, die wir als Gesellschaften gemeinsam getroffen haben, um Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur zu finanzieren. Eine Ausnahme bilden eben die Superreichen: Von den Einkommen der Durchschnittsfranzosen etwa gehen von jedem Euro 50 Cent an den Staat, von jenen der Superreichen hingegen sind es bloss 25 Cent. Studien für viele andere Staaten bestätigen dieses Muster.
WOZ: Viele Länder kannten früher eine Vermögenssteuer – und haben sie abgeschafft. Warum? Was ist schiefgelaufen?
Gabriel Zucman: Ich habe viel Zeit damit verbracht, die historischen Erfahrungen mit der Vermögenssteuer zu analysieren – und bin zum Schluss gekommen, dass sie ein grosses intellektuelles wie politisches Versagen war. Eines der Hauptprobleme früherer Vermögenssteuern war, dass die Staaten nichts unternommen haben, um das Abwanderungsrisiko stark vermögender Menschen einzudämmen. Die Ansicht, Superreiche würden einfach wegziehen, wenn man versucht, sie zu besteuern, ist falsch: Es gibt viele Massnahmen, die Staaten umsetzen können, um dieses Risiko zu mindern.
WOZ: Welche wären das?
Gabriel Zucman: Will ein deutscher Milliardär in die Schweiz ziehen, ist das sein gutes Recht. Aber Deutschland könnte ihn auch nach dem Wegzug weiterhin besteuern – wie lange, darüber kann man diskutieren. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass er nach seinem Umzug keine Steuern mehr an das Land zahlen muss, in dem er sein Vermögen angehäuft hat. Schliesslich wurde er nur deshalb so reich, weil er von den öffentlichen Ausgaben, der Bildung und der Infrastruktur profitierte. Hinzu kommt: Die Vermögenssteuern, die es gab und in der Schweiz, in Norwegen oder Spanien immer noch gibt, sind völlig veraltet. Viele davon wurden Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt. Sie basieren auf Selbstdeklaration – dabei unterschätzen die Leute den Wert bestimmter Vermögen oder vergessen, einen Teil ihrer Immobilien anzugeben. Diese ziemlich archaischen Steuern sollten modernisiert werden – was auch leicht möglich wäre. Der Staat könnte sagen: «Auf Grundlage der uns vorliegenden Infos schätzen wir Ihr Vermögen auf den Betrag x.» Das grösste Problem früherer Vermögenssteuern ist aber, dass gerade die Superreichen davon ausgenommen waren.
WOZ: Wie war das möglich?
Gabriel Zucman: Nehmen wir wieder das Beispiel Frankreich: 1981 führte die sozialistische Regierung eine Art Solidaritätssteuer auf Vermögen ein – und befreite gerade die Reichsten davon, jene, die mehr als 25 Prozent einer Firma besassen. 2016, kurz bevor die Vermögenssteuer abgeschafft wurde, lag der effektive Steuersatz für Milliardäre bei gerade einmal 0,005 Prozent des Vermögens. So kann es natürlich nicht funktionieren. Deshalb schlage ich das Gegenteil vor: Die Mindeststeuer von 2 Prozent gilt nur für Superreiche. Wer mehr als hundert Millionen Euro besitzt und weniger als 2 Prozent des Vermögens an Einkommenssteuer zahlt, muss so viel abgeben, bis er oder sie diesen Schwellenwert erreicht.
WOZ: Die Superreichen von der Vermögenssteuer auszunehmen, war ja ein politischer Entscheid. Hätte Ihr Vorschlag bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen überhaupt Chancen?
Gabriel Zucman: Dass die Vermögen der Superreichen quasi explodiert sind, ist eine der wichtigsten globalökonomischen Entwicklungen im letzten Jahrzehnt. 1987 entsprach der Reichtum der Milliardäre drei Prozent des weltweiten BIP, heute sind es vierzehn. Damals konnte man das Problem also noch ignorieren, weil die Implikationen für das Budget gering waren; heute sind die Folgen in Bezug auf Steuereinnahmen und Ungleichheit wesentlich grösser. Besonders gravierend sind die Implikationen für die Nachhaltigkeit unserer demokratischen Institutionen. Denn mit dem rasanten Wachstum des Vermögens kam auch eine Explosion von Macht und Möglichkeiten, die Politik zu beeinflussen, indem man etwa Medien kauft. Viele denken, es könne so nicht weitergehen.
WOZ: Welche konkreten Folgen hat diese Vermögenskonzentration für die Demokratie?
Gabriel Zucman: Für die meisten ist Vermögen etwas Gutes, es bedeutet Sicherheit bei einem möglichen Jobverlust. Das gilt gerade für die Arbeiter:innenklasse, die derzeit vom Vermögen ausgeschlossen ist. Aber für die Superreichen bedeutet Vermögen nicht Sicherheit, sondern Macht. Sie sammeln das Geld ja nicht für ihre Rente. Eine grosse Vermögenskonzentration geht also immer mit einer grossen Konzentration von Macht einher. Es gibt viele Beispiele dafür, aber das vielleicht auffälligste ist die Entwicklung in den USA: Während der Vorwahlen der Demokraten 2019/20 forderten Leute wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren eine nationale Vermögenssteuer. Ihre Gegner:innen meinten, die Annahme, mit dem Geld komme auch Macht, sei übertrieben und die Reichen hätten ja gar kein Einkommen, weil alles in ihren Firmen stecke.
WOZ: Und was geschah dann?
Gabriel Zucman: Eines Tages wachte Elon Musk mit der Idee auf, Twitter zu kaufen. Er hatte zwar kein Einkommen, konnte die dafür nötigen 44 Milliarden Dollar aber aus dem Stand aufbringen. Dann baute er Twitter zu X um und stellte es in den Dienst von Donald Trumps Wiederwahl. Das wiederum brachte ihn nach Washington, D.C., wo er direkten Zugang zu den Servern der Bundesregierung bekam – mit der totalen Freiheit, jene öffentlichen Ausgaben zu streichen, die ihm nicht passten. Sie sehen also, wie Reichtum direkt in politische Macht mündet.
WOZ: Hat dieser Einfluss auch schon eine fairere Steuerpolitik verhindert, etwa in Bezug auf Ihre Idee in Frankreich?
Gabriel Zucman: Ja, die Superreichen mobilisierten etwa gegen die Vermögenssteuer, die die Nationalversammlung letzten Februar beschlossen hatte. In Frankreich gehören achtzig Prozent der Medien einer Handvoll schwerreicher Personen. Diese Konzentration haben sie äusserst aggressiv dazu genutzt, Ängste zu schüren und irgendwelche dubiosen Studien zu verbreiten. Manche wurden auch sehr persönlich, warfen mir vor, ein linker Fanatiker zu sein, der die französische Wirtschaft zerstören wolle. Sogar die «Financial Times» schrieb, Frankreich zeichne sich durch einen besonders hohen Einfluss seiner Milliardäre auf die Politik aus – was auch daran liegt, dass sie besonders reich sind: 1996 entsprach das Vermögen der 500 reichsten Familien 6 Prozent des BIP, heute sind es 42. Das heisst, sie könnten fast die Hälfte aller Güter und Dienstleistungen kaufen, die in einem Jahr produziert werden. Der Senat lehnte meinen Mindeststeuervorschlag schliesslich ab. Auch wenn Frankreich ein Extrembeispiel ist, das Problem ist global.
Gegner:innen einer Vermögenssteuer sagen, sie würde der Wirtschaft schaden. Was entgegnen Sie?
Gabriel Zucman: In den letzten vier Jahrzehnten wuchs das Vermögen der Milliardäre global im Durchschnitt um acht Prozent pro Jahr. Wenn sie also zwei Prozent Steuern zahlen müssten, betrüge das Wachstum immer noch sechs Prozent. Wie soll das bitte die Wirtschaft zerstören? Es ist im Gegenteil ein wirklich bescheidener Vorschlag!
WOZ: In der Schweiz fordert der Milliardär Fredi Gantner eine ähnliche Steuer. Hatte Ihr Vorschlag Unterstützung von Superreichen?
Gabriel Zucman: Manche sagen, die Superreichen seien die letzte soziale Klasse – mit einem kohärenten Verständnis ihrer Klasseninteressen und der Bereitschaft, diese vehement zu verteidigen. Auch in Bezug auf die Steuer waren sich die französischen Superreichen auffällig einig: Dass sie den Vorschlag ablehnen, ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass er funktioniert hätte. Davon abgesehen ist es aus meiner Sicht auch nicht an den Reichen, zu entscheiden, wie die Steuer für Reiche aussehen soll, und auch nicht an Ökonom:innen, sondern am demokratischen Prozess.
WOZ: Was stimmt Sie so optimistisch für die Einführung und Durchsetzung Ihrer Reichensteuer?
Gabriel Zucman: Die Logik der Mindeststeuer ist extrem bestechend. Hinzu kommt: Der Kampf zwischen Demokratie und Oligarchie ist einer der entscheidenden Kämpfe des 21. Jahrhunderts. Wir stehen an einem Wendepunkt: 2024 hat Grossbritannien die Steuerbefreiung für reiche Ausländer:innen abgeschafft, dann setzte Brasilien die Mindestvermögenssteuer auf die Agenda der G20. 2025 folgte die Debatte in Frankreich. Und kommenden November wird Kalifornien wahrscheinlich über die Einführung einer Fünfprozentsteuer für Milliardäre abstimmen. Vor fünfzig Jahren stand der Bundesstaat an der Spitze einer Antisteuerrevolte: 1978 wurde die «Proposition 13» verabschiedet, eine wegweisende Verfassungsänderung, die die Grundsteuer begrenzte – der Beginn einer grossen konservativen Wende in der US-Steuerpolitik. Nun könnte Kalifornien wieder zur Avantgarde werden. Natürlich hoffe ich, dass es auch in der Schweiz mal eine solche Abstimmung geben wird.



