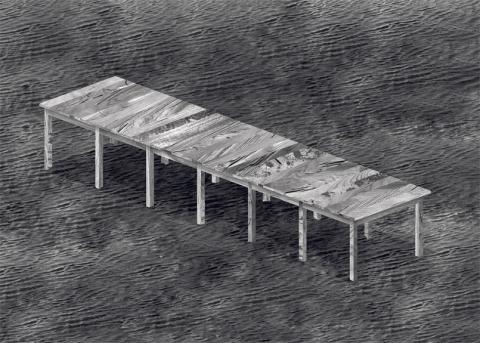Sterbehilfe: Die Freitodhilfewilligen
Warum sucht jemand Hilfe zum Suizid? Warum leisten andere diese Hilfe freiwillig? Exit hat sich in die Karten blicken lassen.
Als die Schweizer Freitodhilfeorganisation Dignitas 2005 ankündigte, in Hannover eine Dependance zu eröffnen, schreckte sie die deutsche Öffentlichkeit auf. Vor dem Hintergrund der laufenden deutschen Sterbehilfediskussion und den Bestrebungen, die rechtlichen Beschränkungen zu lockern, trieb diese Ankündigung neues Wasser auf die Debattenmühle. Nun hat eine deutsche Autorin ein Buch zum Thema geschrieben.
Im Zentrum von Svenja Flasspöhlers Buch steht die Freitodhilfeorganisation Exit. Anders als Dignitas unterstützt sie nur Schweizer BürgerInnen und lehnt den «Sterbetourismus» ab. Vielleicht war das der Grund, weshalb Exit und nicht Dignitas sich in die Karten respektive in die Akten schauen liess. 154 Menschen sekundierte Exit 2006 beim freiwilligen Tod; bei Dignitas waren es 192, davon 118 Deutsche. Dieses Zahlenverhältnis scheint angesichts der Tatsache, dass Exit mit 50 000 Mitgliedern zehnmal grösser ist als Dignitas, für eine gewisse Seriosität zu sprechen. Doch was veranlasst Menschen überhaupt, bei einer Einrichtung wie Exit Hilfe zu suchen? Warum stellen sich deren MitarbeiterInnen ehrenamtlich zur Verfügung, anderen Menschen bei diesem schwierigen letzten Gang zur Seite zu stehen?
Zunächst beklagt Flasspöhler die «fatale begriffliche Unschärfe», durch die die «Beihilfe zur Selbsttötung» in einen Topf mit aktiver Sterbehilfe (die in Deutschland wie in der Schweiz verboten ist) geworfen werde. Wer nämlich «lebensmüde» ist und glaubt, Schmerzen nicht mehr ertragen zu können oder unter einer «unzumutbaren Behinderung» leidet, muss sich den Becher mit dem tödlichen Natrium-Pentobarbital schon selbst zum Mund führen respektive den Infusionshebel selbst umlegen. Bevor es so weit kommt, obliegt es den FreitodbegleiterInnen, zu überprüfen, ob der Sterbewillige tatsächlich «unzumutbar» leidet und sein Wunsch «wohlerwogen» und «dauerhaft» ist.
In der Regel wendet sich das Exit-Mitglied an die Organisation und bittet um Hilfe. In einem Erstgespräch verschafft sich der oder die FreitodbegleiterIn einen Überblick über die Situation, prüft ärztliche Gutachten, fragt nach der Haltung der Angehörigen zum Sterbewunsch und fertigt ein Protokoll an. In einer Checkliste wird festgehalten, ob die PatientInnen urteilsfähig sind, wie ihr Krankheitszustand zu beurteilen ist, ob sie an Depressionen leiden und ob Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden kann. Schliesslich wird der Fall nach Aktenlage entschieden; von 300 Anträgen wurde 2006 die Hälfte befürwortet. Weitere Gespräche finden in der Regel nicht statt, auch die Angehörigen werden nicht kontaktiert. Obwohl sich Exit bei PatientInnen mit psychischen Leiden zurückhaltender zeigt als bei somatischen, haben auch diese neuerdings wieder eine Chance, dass ihr Sterbewunsch erfüllt wird: Entscheidend sei der Wille der Betroffenen, ihr Selbstbestimmungsrecht gelte es zu achten.
Lässt sich ein solcher Wille in einem einzigen Gespräch prüfen - von FreitodbegleiterInnen, die nur im Rahmen eines eintägigen Assessement auf diese Aufgabe vorbereitet wurden (zum Vergleich: In Deutschland werden beispielsweise ehrenamtliche HospizhelferInnen mehrere Monate lang in die Sterbebegleitung eingewiesen)? Gibt es objektive Massstäbe für subjektiv empfundenen Schmerz? Und wer entscheidet, was «unzumutbar» ist? Denn nicht nur «hoffnungslose Fälle» suchen bei Freitodhilfeorganisationen Hilfe; auch einsame Menschen, die körperlich oder psychisch eingeschränkt sind, wollen ihrem Leben ein Ende setzen. Exit bietet eben nicht nur Begleitung in aussichtsloser Lage, sondern Hilfe beim Suizid an. Wer sich an sie wendet, will den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmen und ohne Schmerzen und in würdiger Umgebung sterben. Doch die Tatsache, dass Freitodhilfeorganisationen ihre BegleiterInnen nicht bezahlen dürfen, birgt auch Probleme: Exit zum Beispiel ist chronisch unterbesetzt, die MitarbeiterInnen haben wenig Zeit. Nach einem Gang durch die Geschichte des Selbstmords nähert sich Flasspöhler den zentralen Problemfeldern ihres Themas sehr vorsichtig. Sie lotet das Terrain aus, setzt berechtigte Ansprüche auf Selbstbestimmung gegen den unverzichtbaren Schutz des Lebens, wägt die Härte somatischen Schmerzes gegen psychisches Leid, Lebenspflicht gegen Sterberecht ab. Sie will keine Stellungnahme liefern, sondern einen Denk-raum eröffnen. Das führt dazu, dass ihre Ausführungen manchmal etwas vage erscheinen. Die abschliessenden Reportagen über die beiden Freitodbegleitungen sind verdienstvoll, auch wenn sie mitunter einen kumpelhaften Ton anschlagen und dazu neigen, kräftig zu «menscheln».
Keinen Zweifel lässt die Autorin allerdings daran, dass der zunehmende Kostendruck im Gesundheitssystem und der Trend zur Entsolidarisierung dazu führen könnten, ein mögliches Recht in eine Pflicht zu verkehren. Der selbstbestimmte Tod würde auf diese Weise zu einer Bringschuld. SterbehilfebegleiterInnen wären dann nicht mehr, wie es ein Exit-Mitarbeiter formuliert, «Werkzeug des Patienten», sondern Werkzeug einer inhumanen Gesellschaft.
Svenja Flasspöhler: Mein Wille geschehe. Sterben in Zeiten der Freitodhilfe. Wolf Jobst Siedler, Berlin 2007. 158 Seiten. Fr. 31.90