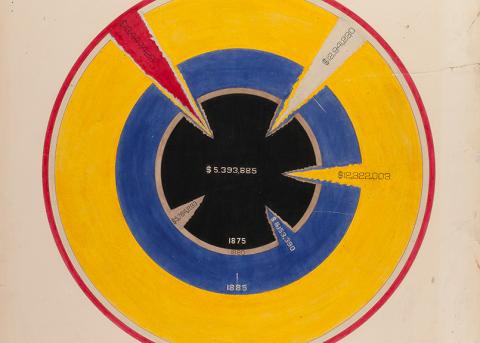Martin Luther King : Zuerst ein Nestbeschmutzer, dann eine nationale Ikone
Keine politische Rede wird in der populären Musik häufiger zitiert als Martin Luther Kings «I have a dream». Wo sich Kings Spuren in der Musik von heute finden, fünfzig Jahre nach seiner Rede. Und wie sich die politische Rhetorik in der populären Musik seither verändert hat.

«Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird … free at last.»
So spricht Martin Luther King, angekündigt als «moralischer Anführer unserer Nation», beim Marsch auf Washington am 28. August 1963 vor 250 000 Leuten am Lincoln Memorial. Keine politische Rede wird in der populären Musik häufiger zitiert oder gesampelt. Der Jazzschlagzeuger Max Roach verwendet «I have a dream» ebenso wie der Chicagoer House-Produzent Gene Farris für seinen Track «Black History». Jahrzehnte nach seiner Ermordung 1968 hat Kings Rede nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Er selbst wird in unzähligen Songs gewürdigt, von JazzerInnen wie Duke Ellington und Herbie Hancock, von Nina Simone und den Staples Singers, auch von UB40 und U2. Auf King, und da beginnt das Problem, können sich (fast) alle einigen. Und Tote können sich nicht gegen falsche Vereinnahmung wehren.
Ein Fall von Geschichtsrevisionismus
Fünfzig Jahre nach dem Marsch auf Washington verkommt Martin Luther King zum patriotischen Maskottchen, zum Symbol des US-amerikanischen Fortschritts. Er wird politisch vereinnahmt, seine Message korrumpiert. Mit dieser Diagnose platzt Gary Younge in die Geburtstagsparty. Mit einem grossen Artikel in «The Nation» spuckt der renommierte afrobritische Autor in die harmonische Jubiläumssuppe. Younge wendet sich gegen die Kommodifizierung der kingschen Politik, gegen «that repackaging of history». Die «Neuverpackung der Geschichte» beruhe auf einer systematischen Verdrängung historischer Fakten. Younge erinnert daran, dass King zu Lebzeiten von der grossen Mehrheit der US-AmerikanerInnen abgelehnt wurde. Einer aus dieser anonymen Masse brachte ihn schliesslich zur Strecke.
Auf den Tag genau ein Jahr vor seiner Ermordung hielt King eine Rede in der New Yorker Riverside-Kirche, die so gar nicht in den patriotischen Kanon passen will. «Beyond Vietnam» ist der Titel der Ansprache, in der King die amerikanische Kriegspolitik attackiert, für das «Life»-Magazin eine «demagogische Verunglimpfung» und «eine Propagandavorlage für Radio Hanoi». Posthum wird aus dem Nestbeschmutzer eine nationale Ikone. Seine «Dream»-Rede wird aber auch gegen ihre Intentionen kooptiert – besonders dreist von Ronald Reagan. Der grosse Manipulator zitiert King 1986 als Kronzeugen für die Abschaffung der «affirmative action», also der Fördermassnahmen und Quotierungen für AfroamerikanerInnen als Kompensation für Sklaverei und Segregation. «Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Chancen haben, deswegen sind wir gegen jede Quote», so Reagan. «Wir wollen eine farbenblinde Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der man, mit den Worten Dr. Kings, die Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt.»
Ein Fall von Geschichtsrevisionismus, war doch King ein Verfechter der «affirmative action». Die Gesellschaft müsse speziell etwas für die AfroamerikanerInnen tun, weil sie über Jahrhunderte speziell etwas gegen sie getan habe. Bewusst missverstanden, reduziert auf Bekömmliches, umgedeutet – so steht Kings Rede zum Jubiläum da. Der Traum von der rechtlichen Gleichstellung sei erfüllt, so Gary Younge in «The Nation», der Traum vom Ende des Rassismus dagegen nicht. «Die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen ist doppelt so hoch wie unter Weissen, die Anzahl schwarzer Kinder, die in Armut leben, ist fast dreimal so hoch wie die der Weissen, die Lebenserwartung schwarzer Männer in Washington DC ist niedriger als die im Gazastreifen.»
Ein Riot findet nicht statt
Das böse Erwachen aus dem schönen Traum beginnt spätestens mit Kings Ermordung und spiegelt sich in der US-(afro)amerikanischen Musik. In «Abraham, Martin and John», der Coverversion eines Dion-Hits, trauert der Soulsänger Marvin Gaye noch introvertiert um Lincoln, King und Kennedy, doch schon bald wird die Stimmung düster. Exemplarisch kann man diesen Wandel an der Karriere von Sly and the Family Stone ablesen. Sly und seine gecastete Patchworkfamilie sind in den späten sechziger Jahren die fleischgewordene Utopie der Integration, sie performen den American Dream des Dr. King: Schwarze, Weisse, Männer, Frauen an Keyboards und Trompete, nicht bloss singend und tanzend, das Line-Up betont die vielstimmige «variety» und verstärkt die populär-universalistischen Titel ihrer Hits: «Everybody Is a Star», «Stand (for Your Rights)», «Everyday People», «I Want to Take You Higher», «Dance to the Music». Die Family-Euphorie kippt 1971 mit «There’s a Riot Goin’ On» (Ein Aufruhr findet statt). Die LP ist mehr als die Antwort auf «What’s Goin’ On?» (Was ist los?), Marvin Gayes Vietnam-«Inner City Blues»-Album, das ein halbes Jahr vor «Riot» erschienen war. Das Plattenlabel verzeichnet «There’s a Riot Goin’ On» als sechsten Song von Seite eins. Spielzeit: 0.00. Ein Riot findet nicht statt. «Das Album ist aus dem Gefühl heraus entstanden, dass die positiven Vorstellungen der sechziger Jahre an ihre Grenzen gestossen waren, sich gegen sich selbst gekehrt und dort Unheil angerichtet hatten, wo nur Gutes erwartet worden war», so der US-amerikanische Pophistoriker Greil Marcus.
Auch Marshall Lewis, der Biograf von Sly Stone, sieht einen Paradigmenwechsel Anfang der siebziger Jahre: «Alles, wofür Sly and the Family Stone standen, war plötzlich nicht mehr angesagt. Protagonisten des politischen Wandels waren ermordet worden, mit Richard Nixon übernahm ein Hardliner und Betrüger das Weisse Haus. Das Konzept der Integration, das Sly and the Family Stone repräsentiert hatten, wurde infrage gestellt, als immer klarer wurde, dass vor allem die schwarze Mittelklasse von der Bürgerrechtsbewegung profitiert hatte.»
Reich werden und jung sterben
Wenn nur die schwarze Mittelklasse von der Bürgerrechtsbewegung profitiert, dann muss die schwarze Unterklasse anders an Geld kommen. Das Ende der Integrationshipness von Sly and the Family Stone markiert den Aufstieg der Gangsterökonomie und – später – des dazugehörigen Life- und Popstyles namens Gangsterrap.
Kings Politik des gewaltlosen Widerstands – Wenn du geohrfeigt wirst, halte die andere Wange hin – hat nach seinem gewaltsamen Tod keine Zukunft, die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen (Musikpoet Gil Scott-Heron), und sie wird nicht ohne Gewalt auskommen, wie Nina Simone in ihrer radikalen Reformulierung des Beatles-Songs «Revolution» feststellt.
Mit «Happy Birthday!» unterstützt Stevie Wonder 1981 die Kampagne für einen Nationalfeiertag an Martin Luther Kings Geburtstag. Das diene der Integration und bringe «Liebe und Eintracht für alle Kinder Gottes». Präsident Reagan gibt sein Okay, aber das Symbol bleibt umkämpft. Evan Mecham, Gouverneur von Arizona, schafft den Feiertag 1988 ab: «King hat viel für die Farbigen getan, aber er verdient keinen Nationalfeiertag.» Public Enemy antworten mit dem Song «By the Time I Get to Arizona». Das Video dazu gipfelt in einem Bombenanschlag auf den Gouverneur, ausgeführt von Public-Enemy-Rapper Chuck D. MTV strahlt den Clip aus – ein einziges Mal. Dann wird Chuck D. zum Buhmann der Nation, das Video sei «das exakte Gegenteil der Message, für die Martin Luther King gestorben ist», so der Tenor.
29 Jahre nach «I have a dream», April 1992: Der Fall Rodney King mit den anschliessenden Riots lässt Leute, die noch an MLKs gewaltlose Politik glauben, als naive Träumer dastehen. King der Stunde ist Rodney, fast totgeschlagen von der Polizei in L. A. Der Sound dazu heisst «Fuck Tha Police» und kommt von N. W. A. – Niggaz Wit Attitudes. Die «attitude» ist nicht: Halt die andere Wange hin. Compton und South Central, die Brutstätten des Gangsterrap, werden zum Symbol der gescheiterten Integration, statt «love and unity» wird der «gang war» zur Matrix gesellschaftlicher Prozesse. «2 Live and Die in L. A.», rappt 2Pac, «Ready to Die» heisst das grosse Album von Biggie Smalls, beide werden reich und sterben jung. «Get Rich or Die Tryin’» (Werde reich oder stirb beim Versuch) – vierzig Jahre nach «I have a dream» formuliert der Rapper 50 Cent mit seinem Bestsellerdebüt den Traum vieler AfroamerikanerInnen, neun Kugeln im Körper des einstigen Crackdealers authentifizierten die Message beinahe. 50 Cent überlebte.
Darwins Recht des Stärkeren
Vom Crackdealer zum Milliardär – Shawn Carter alias Jay Z wurde reich, ohne zu sterben, ein Überlebender im Gangsterkapitalismus. An seiner Seite die Sängerin Beyoncé. Mit ihrem flexiblen Ellbogenfeminismus und dem unbedingten Aufstiegswillen verkörpert Beyoncé die First Lady im «Power Couple Nummer zwei der African American Aristocracy» (Sonja Eismann). Mit Michelle und Barack Obama, dem Power Couple Nummer eins, ist man gut befreundet. In heutigen Kämpfen um gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe hat Beyoncés «Independence» dem «Respect» von Aretha Franklin als Leitmotiv den Rang abgelaufen. Beyoncé ermutigt Frauen zur Unabhängigkeit vom männlichen Versorger, der ja oft bloss ein Rolling Stone ist: «Where ever he laid his hat, was his home» (Wo immer er seinen Hut hinlegte, war sein Zuhause). Sie propagiert aber auch Unabhängigkeit vom Staat, von «affirmative action», von «welfare» (Wohlfahrtsstaat). Oder von einer wie auch immer gearteten politischen Bewegung. Auf dem deregulierten Markt gilt Darwins Recht des Stärkeren.
Fünfzig Jahre nach «I have a dream» sind die Idole des schwarzen Amerika Rapper wie Jay Z. und Kanye West. Sie haben sich nach oben geboxt und nutzen ihre Popularität hin und wieder für politische Statements. «George Bush doesn’t care for black people» (George Bush sind die Schwarzen egal) – seit dem Hurrikan Katrina ist dieser Ausspruch von Kanye West ein geflügeltes Wort. Jetzt sind es die neuen SklavInnen. Mit dem Song «New Slaves» hat West eine Debatte über das amerikanische Gefängnissystem ausgelöst. «Heute sitzen mehr Afroamerikaner im Gefängnis, als es Mitte des 19. Jahrhunderts Sklaven gab», so West. Zwischen 1970 und 2005 sei die Zahl der Inhaftierten um 700 Prozent gewachsen, davon überdurchschnittlich viele AfroamerikanerInnen. Wenn dieser Trend anhält, dann wird einer von drei schwarzen Männern, die heute geboren werden, im Gefängnis landen. Free at last!
Dem Vater nachgefolgt
Martin Luther King kam am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia, als Michael King junior zur Welt. Sein Vater, Martin Luther King senior, war Baptistenprediger einer Ebenezergemeinde in Atlanta und bereits vor der Geburt von King junior Vorsitzender der Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Der Sohn trat in die Fussstapfen des Vaters und wurde Mitte der fünfziger Jahre zum bekanntesten und bedeutendsten Sprecher – und Redner – der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. King war ein religiös motivierter Verfechter des gewaltlosen Widerstands, 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde er in Memphis, Tennessee, erschossen. Er hinterliess eine Frau und vier Kinder. Die Umstände seiner Ermordung wurden nie ganz aufgeklärt, bis heute kursieren Verschwörungstheorien.