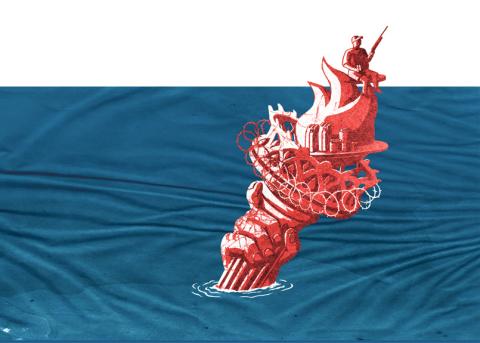Anarchismus: «Der Staat macht das Leben der Menschen unsicherer»
Libertäre würden den Staat und seine Institutionen am liebsten abschaffen: Das hat die No-Billag-Initiative gezeigt. Aber sind libertäre Ideen immer rechts? Und worin unterscheiden sich die Vorstellungen der AnarchokapitalistInnen von der Tradition des Anarchismus? Der Philosoph Daniel Loick im Gespräch.

WOZ: Herr Loick, würden Sie sich selbst als libertär bezeichnen?
Daniel Loick: Das hängt davon ab, was Sie mit «libertär» meinen. Der deutsche Begriff «libertär» hat eine andere Bedeutung als das, was man in den USA mit «libertarian» bezeichnet. Ich würde mich schon positiv auf die libertäre Tradition beziehen wollen, wenn der Begriff im Sinne der deutschen Diskussion verwendet wird, wo ein Begriff wie «libertärer Sozialismus» keinen Widerspruch darstellt. Ihm liegt nämlich ein sozialer Begriff von Freiheit zugrunde. Gleichzeitig drückt das Attribut «libertär» eine Distanz zu autoritären Sozialismuskonzeptionen aus.
Wie genau definiert sich denn der amerikanische «libertarianism»?
Hier wird Freiheit so verstanden, dass die soziale Komponente praktisch keine Rolle spielt. Stattdessen steht das Individuum im Mittelpunkt – weswegen alle Formen von staatlicher Regulierung als problematisch betrachtet werden, weil sie die Freiheit des Einzelnen einschränken. Es gibt dann gar keinen Bezug mehr auf die Gemeinschaft. Das wiederum impliziert problematische Vorstellungen vom menschlichen Zusammenleben.
Dieser starke Individualismus ist auch einer der Gründe dafür, warum man in den USA so verbissen am Recht auf Waffenbesitz festhält, nicht?
Ja, in den USA ist die Vorstellung stark verankert, dass das «Second Amendment» – also das Recht, Waffen zu tragen – einen Schutz vor Tyrannei bedeutet. Interessanterweise ist es aber auch erst seit einigen Jahren so, dass dieses Recht als ein individuelles begriffen wird. Davor verstand man das «right to bear arms» als ein Recht, Teil einer Miliz zu werden. Aber es stimmt, in den USA sind Vorstellungen, die den Einzelnen in den Mittelpunkt stellen, sehr verbreitet. Das kann ja auch positiv sein, wie etwa bei der Betonung der unbedingten Redefreiheit. Andererseits schlägt sich der Individualismus auch in einer pauschalen Kritik an der Besteuerung der Bürger durch den Staat nieder. So erklärt sich dann auch die für uns seltsam anmutende Vorstellung, die Einführung einer obligatorischen Krankenversicherung sei eine Verletzung der Freiheit des Individuums.
Hat diese Art des Libertarismus in den vergangenen Jahren verstärkt auch in Europa Verbreitung gefunden?
Es gibt jedenfalls auch hierzulande solche Strömungen. Aber ich kann nicht einschätzen, ob das in Europa ein allgemeiner Trend ist. Eher können wir ja den Vormarsch reaktionärer Gemeinschaftsideologien beobachten, die die Rückkehr zum «Volk» propagieren – und hier wird ja nicht die individuelle Freiheit ins Zentrum gestellt. Insgesamt zeichnet sich rechts eher ein heterogenes Bild ab: Es gibt Bewegungen, die im Stil des amerikanischen Anarchokapitalismus argumentieren, also den Staat am liebsten abschaffen und alles dem freien Markt überlassen würden. Gleichzeitig werden ethnische Gemeinschaftsideale sowie ein Souveränitätsdenken propagiert, wie es etwa beim Brexit zum Tragen kam.
In einem Interview mit der WOZ hat ein Basler Rechtslibertärer kürzlich gesagt: «Lieber ab und zu ein Mafiageballer als einen hochgerüsteten Staat. Nur Staaten haben Armeen und zetteln Weltkriege an.» Sie bezeichnen in Ihrer Anarchismuseinführung den Staat als das «grösste Sicherheitsrisiko der Menschheitsgeschichte». In der Ablehnung des Staates stimmen Anarchismus und Libertarismus also überein?
Ich kenne den Zusammenhang nicht, aus dem das Zitat des Schweizer Libertären stammt, aber ich würde entgegnen, dass das Ziel einer anarchistischen Staatskritik die Überwindung von Gewalt als solcher ist. Diese Kritik setzt daran an, dass der Staat für sich beansprucht, die vorstaatliche Gewalt zu beenden, indem er die Gewalt monopolisiert. Die anarchistische Kritik legt dabei den Finger auf die ironischen Effekte dieses staatlichen Anspruchs: Die Monopolisierung der Gewalt führt nämlich dazu, dass die Menschen wiederum unsicherer werden.
Wieso das?
Zum Beispiel, weil die Polizei selbst dazu neigt, Rechtsverstösse zu begehen. Ein besonders krasses Beispiel ist die Atombombe: Dass es solch extreme Gewaltmittel gibt, bei denen die Fortexistenz der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht, ist überhaupt nur unter den Bedingungen von Staatlichkeit denkbar. Daran lässt sich nun ablesen, dass das Argument, der Staat beende die Gewalt, nicht funktioniert – im Gegenteil: Der Staat macht das Leben der Menschen unsicherer.
Genau so argumentiert der Rechtslibertäre doch auch …
Das Ziel der anarchistischen Kritik ist aber nicht, das Mafiageballer zu legitimieren, sondern neue Formen des menschlichen Zusammenlebens zu finden, die auf Gewalt verzichten. Es geht also darum, nicht hinter die Staatsgewalt zurückzufallen, sondern über sie hinauszugehen. Genau dies ist ein Unterscheidungskriterium zwischen individualistischen Vorstellungen von Anarchismus und sozialistischen oder kommunistischen Anarchismen, bei denen man gerade darüber nachdenkt, wie man in der Gemeinschaft neue Formen der Kooperation entwickeln könnte.
Deswegen haben Sozialistinnen und Sozialisten das liberale Menschenbild, das auf den Einzelnen fokussiert ist, immer kritisiert …
Ja, die sozialistische Antwort auf dieses liberale Menschenbild war von jeher die Vorstellung vom Menschen als sozialem Wesen, das anderen Menschen gegenüber zur Anteilnahme fähig ist. Versucht man nun, diese sozialen Bindungen zu intensivieren, und baut darauf, dass aus gemeinschaftlicher Kooperation neue Potenziale erwachsen, um Konflikte zu schlichten, könnte das auch dazu führen, dass man mehr und mehr auf eine äussere Zwangsgewalt verzichten kann.
Aber sind Anarchismus und Sozialismus nicht Widersprüche? Sozialistinnen und vor allem Marxisten haben den Anarchismus doch immer als «kleinbürgerliche Ideologie» gebrandmarkt.
Der Anarchismus ist eine extrem vielfältige Strömung. Tatsächlich sind einige dieser Strömungen antisozialistisch, da sie gegen die Gemeinschaft gerichtet sind. Zu nennen wäre hier der Philosoph Max Stirner, ein Zeitgenosse von Karl Marx, der sich zwar nicht selbst als Anarchist bezeichnet hat, aber häufig als Exponent dieser Strömungen angeführt wird. Gesellschaftlich relevant geworden ist der Anarchismus allerdings immer dort, wo er sich als Teil des Sozialismus und als soziale Bewegung verstanden hat. Dafür stehen auch alle berühmten Namen.
Also beispielsweise Proudhon oder Bakunin …
… oder Kropotkin: Sie alle waren sozialistisch bis kommunistisch. Vom Marxismus abgegrenzt haben sie sich eher wegen dessen Staatsvorstellung. Diese unterschiedlichen anarchistischen Strömungen trennen sich entlang des Freiheitsbegriffs: Geht man davon aus, dass der andere Mensch die Grenze meiner eigenen Freiheit darstellt – so wie es der Liberalismus tut? Das entspräche dem sogenannten negativen Freiheitsbegriff. Oder geht man davon aus, dass der andere nicht die Grenze, sondern die Bedingung meiner Freiheit ist – dass Freiheit also darin besteht, dass ich an sozialen Praktiken partizipiere und mich in diesen Praktiken, die wir miteinander teilen, zu Hause fühle? Das drückt Marx, der ja kein Anarchist war, treffend mit dem Satz aus, dass die Freiheit aller die Bedingung für die Freiheit des Einzelnen ist und umgekehrt.
Gerade in der Gegenwart scheint die Frage, wie genau Freiheit zu definieren ist, sehr umstritten zu sein: Für Neoliberale ist Freiheit ja auch ein zentraler Wert, nur ist damit dann diejenige des Unternehmers gemeint.
Das ist auf jeden Fall auch ein politischer Konflikt. Persönlich finde ich natürlich den sozialen Freiheitsbegriff viel sympathischer als den liberalen, aber gleichzeitig ist es zweifellos so, dass das Konzept der sozialen Freiheit stark in der Defensive ist. Gesellschaftlich vorherrschend ist derzeit die neoliberale Vorstellung, dass Freiheit in der Selbstverwirklichung des Einzelnen liegt. Damit handelt man sich aber regelmässig wiederum bestimmte ironische Effekte ein, die dann erneut Freiheit untergraben.
Wie zum Beispiel?
Der Soziologe Luc Boltanski und die Soziologin Ève Chiapello haben beschrieben, wie Ideale, die ursprünglich die Freiheit vergrössern sollten, plötzlich zu neuen Zwängen werden. Dann heisst es: Du sollst kreativ sein! Du sollst dich selbst verwirklichen! Was psychologisch wiederum zu Phänomenen wie Burn-out, Depressionen oder Ähnlichem führen kann. All dies resultiert aus einer falsch verstandenen, nämlich abstrakten und leeren Freiheit.
Möglicherweise erklärt das ja auch, warum gerade nationalistische Ideologien so viel Zulauf erfahren …
Ja, das ist eine interessante Dialektik: Eigentlich erscheinen «Volk» und Individuum als Widerspruch. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass der Zuspruch, den rechte Gemeinschaftsangebote finden, nur so zu erklären ist – nämlich als Reaktion auf die reale Atomisierung der Gesellschaft. Die Menschen erfahren nicht mehr in ihrem Alltag, in ihren wirklichen Lebensvollzügen, dass sie miteinander verbunden sind. Deswegen greift man dann auf abstrakte Ideale wie «Vaterland» oder «Volk» zurück, also Konzepte, die konkret gar nicht erfahrbar sind, aber Zusammenhalt zwischen den Vereinzelten stiften sollen.
Die Antwort der Sozialistinnen und Sozialisten darauf war immer, Solidarität zu propagieren – ebenfalls mit dem Ziel, die partikularistische Beschränkung der Einzelnen aufzuheben, aber nicht in einem nationalen oder gar ethnischen Rahmen, sondern mit einem universellen Anspruch. Das heisst, dass zu der so geschaffenen Gemeinschaft alle gehören, dass diese Gemeinschaft offen ist und Raum für Pluralität bietet.
Sehen Sie irgendwo in der Gegenwart konkrete Beispiele, wo soziale Freiheit wirklich erfahrbar wird?
Man kann schon vielversprechende Ansätze finden. So gibt es in manchen Ländern linkssozialdemokratische Bewegungen: Bernie Sanders repräsentiert dies in den USA, Jeremy Corbyn in Britannien. In beiden Fällen steht der Gedanke der Solidarität im Zentrum. Ebenso anarchistischere Phänomene wie die Occupy-Bewegung. Auch Hausbesetzungen sind interessant, da dabei das Eigentumsrecht, also der Kern der liberalen Rechtsvorstellung, durch eine gemeinschaftliche Aktion infrage gestellt wird. Dazu kommen noch sehr viele im Lokalen zu beobachtende Formen emanzipatorischer Politik, die nicht auf dem grossen Radar erscheinen, aber solche Gemeinschaftserfahrungen ermöglichen.
Sie beziehen sich immer wieder positiv auf den Begriff «Gemeinschaft». Das Wort klingt ein wenig unheimlich.
Das stimmt, man muss mit diesem Begriff aufpassen, gerade im Deutschen, wo «Gemeinschaft» eine reaktionäre oder gar völkische Note haben kann. Ich würde mich damit auch eher auf das amerikanische «Community» beziehen, ein gerade für People of Color in den USA wichtiger Begriff. Es geht dabei um eine Form von Gemeinschaft, die Heterogenität erlaubt oder sogar erfordert.
Wenn man sich praktische Versuche anschaut, gemeinschaftlich jenseits von Staat und Kapital zu leben: In der Zone à défendre im französischen Nantes, einer grossen linken Besetzung, gibt es keine Polizei, Konflikte werden von Mediatorinnen und Mediatoren gelöst, und dies auch in krassen Fällen, etwa wenn es um Vergewaltigungen geht. Klingt das nicht auch ein bisschen gruselig?
Auch in diesen Fällen gilt die Devise: Man muss über die staatlichen Verlaufsformen hinausgehen und darf nicht hinter sie zurückfallen. Danach, inwieweit dies gelingt, muss man dann den jeweiligen Versuch beurteilen. In einigen Communities of Color in den USA, die sowieso darauf angewiesen sind, ihre Konflikte ohne die Staatsgewalt zu lösen, weil sie niemals auf die Idee kommen würden, selbst die – regelmässig rassistische – Polizei zu rufen, gibt es kreative Versuche, mit Gewalt in den eigenen Gemeinschaften umzugehen. Hierzu zählen etwa Konzepte wie die Community Accountability und die Transformative Justice, bei denen es darum geht, die konkreten Bedürfnisse der betroffenen Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, die Täter aber ebenfalls in den Prozess mit einzubeziehen. Natürlich sind diese Methoden nicht perfekt. Trotzdem wäre ich solchen Projekten gegenüber erst einmal solidarisch.
Ist nicht manchmal auch ein naives Menschenbild das Problem, dass man einfach davon ausgeht, der Mensch sei im Kern gut, und sich sagt: Jetzt ziehe ich in die Kommune, und dann werden schon Freiheit und Brüderlichkeit herrschen?
Auch ich hätte wohl bei vielen anarchistischen Projekten meine Probleme, weil ich auch nicht unbedingt in einer Landkommune wohnen will. Historisch betrachtet herrschten bei derartigen Projekten häufig problematische Zurück-zur-Natur-Vorstellungen, konformistische Gemeinschaftsideale oder auch ein starker Moralismus, der abweichendes Verhalten des Einzelnen als Egoismus brandmarkte. Und der Insurrektionalismus, also der aufständische Anarchismus, ist mir viel zu heroisch in seiner Propagierung eines gleichsam apokalyptischen Kampfes.
Man sollte daher versuchen, bestimmte Ideen aufzunehmen, und fragen, wie diese unter den jetzigen Bedingungen aktualisiert werden können. Und da würde ich sagen: Die heutige Kommune muss eben eine Form von Gemeinschaft sein, die die Computertechnologie mit einplant.
Apropos Insurrektionalismus: Auch vielen Linken stösst bei der Schrift vom «Kommenden Aufstand» auf, dass die Verfasserinnen und Verfasser – ein anarchistisches Kollektiv aus Frankreich – sich so positiv auf Gewalt beziehen. Wie beurteilen Sie das?
Geschichtlich gesehen gab es im Anarchismus immer wieder Gewaltdebatten, etwa um die «Propaganda der Tat», bei der es darum ging, durch spektakuläre Aktionen Einzelner – Attentate beispielsweise – die Massen aufzurütteln. Diese Strategie gab man aber schnell auf, weil sie nicht funktionierte. Man könnte auch das diskutieren, was unter dem Schlagwort «Direkte Aktion» gefasst wird: Sabotage oder Streiks, also Aktionsformen, die zumindest Gewalt gegen Sachen befürworten.
Was den «Kommenden Aufstand» angeht, halte ich vor allem den imaginären Horizont, der da mit dran hängt, für ein Problem. Darin spiegelt sich eine geradezu apokalyptische Vorstellung von Gesellschaftsveränderung, so nach dem Motto: Erst einmal muss alles zusammenbrechen, ehe sich etwas tut. Gesellschaftliche Transformation hat aber mehr mit der konstruktiven Etablierung neuer Beziehungen zu tun als mit dem Abräumen der alten.
Wenn man sich anschaut, wie quasimilitärisch auch der Schwarze Block bisweilen auftritt – ist das nicht fast schon rechts?
Ich würde das so nicht unterschreiben. In der Vorstellung von der Apokalypse als quasinotwendiger Übergangsphase zur Befreiung stecken sicher Gefahren. Aber trotzdem hat der Anarchismus noch andere Reserven, die ihn von faschistischen Vorstellungen abgrenzen. Ein signifikanter Unterschied besteht allein schon darin, wie sich das gemeinsame Subjekt zusammensetzt: Der Schwarze Block ist immer von vornherein internationalistisch ausgerichtet – da kommen Leute aus allen Ländern zusammen. Trotzdem werden gewisse maskulinistische Militanzvorstellungen von anarchistisch-feministischer Seite schon lange als Mackerscheiss kritisiert – und das zu Recht.
Könnte dieses militante Auftreten nicht auch eine Art Ersatzhandlung sein, weil der Anarchismus heute keine Massenbasis mehr hat?
Ich will mich der Klage über die Militanz im Schwarzen Block nicht so recht anschliessen. Natürlich ist es viel zu bequem, wenn man linke Gewalt einfach als «Gegengewalt» definiert und damit schon für gerechtfertigt hält. Aber dennoch: Wenn man sich die Debatte rund um den G20-Gipfel in Hamburg vergegenwärtigt und sich gleichzeitig klarmacht, dass dort Trump, Erdogan, Putin versammelt waren, erscheint es mir verquer, vor allem über brennende Autos zu diskutieren. Da finde ich es durchaus wichtig, zunächst den Blick auf die real herrschenden Gewaltverhältnisse zurückzulenken. Danach muss man allerdings über die eigene Gegenstrategie diskutieren – also darüber, ob es klug ist, als Schwarzer Block aufzutreten oder Steine zu schmeissen. Und da würde ich sagen, das ist meistens keine gute Strategie.
Es gibt ja auch alternative Aktionskonzepte, etwa die Clown Army.
Oder den Pink Block. Das finde ich sympathisch. Die Frage ist, inwieweit solche Konzepte in allen Situationen wirklich funktionieren.
Gegenwärtig ist die Linke oft in der Position, den Staat vor neoliberalen Angriffen sogar verteidigen zu müssen. Welche Impulse könnte in dieser Situation der Anarchismus liefern?
Es muss darum gehen, neben der neoliberalen Staatskritik und der sozialdemokratischen Staatsverteidigung eine dritte, emanzipatorische Perspektive zu entwickeln. Also bezogen auf das Beispiel «Billag»: Wie sähe eine zivilgesellschaftliche, demokratische – also weder staatliche noch private – Medienöffentlichkeit aus? Wichtige Impulse könnten dabei aus den Debatten um die Commons kommen, also um Güter, die weder privat noch staatlich verwaltet werden, sondern unter zivilgesellschaftlicher Verfügung stehen. Im immateriellen Bereich wäre hier die Internetenzyklopädie Wikipedia ein Beispiel für ein Projekt, das von allen gemacht wird und für alle frei verfügbar ist, aber eben nicht unter staatlicher Federführung steht.
Gleichzeitig gibt es vielerorts Kämpfe um die Commonisierung von städtischen Infrastrukturen – wenn etwa versucht wird, Kulturinstitutionen oder allgemein öffentliche Güter unter gemeinschaftliche Verfügung zu stellen: Free-Wifi zum Beispiel, freie Fahrräder, frei zugängliche Museen. Diese Ansätze gilt es zuzuspitzen und auf andere Bereiche auszuweiten.
Glauben Sie wirklich, solche Ansätze könnten ausreichend gesellschaftliche Durchschlagskraft entwickeln?
Das ist immer das Gegenargument. Aber nehmen Sie Griechenland als Beispiel: Dort gab es den Versuch, mittels einer Partei – Syriza – Veränderungen zu erreichen, was grandios gescheitert ist. Im Windschatten von Syriza aber entstanden zahlreiche soziale Praktiken: von Besetzungen über Tauschringe bis hin zu freien medizinischen Angeboten. Hier hat sich eine alternative Ökonomie herausgebildet.

Wenn man das diesen Projekten zugrunde liegende Prinzip der gemeinschaftlichen Produktion und freien Verfügbarkeit auch auf die materielle Ökonomie anwenden würde, dann könnte es richtig interessant werden. Das mag utopisch klingen. Aber es ist gerade heute wichtig, solche Alternativen zum Status quo ins Spiel zu bringen.
Daniel Loick
Der Philosoph Daniel Loick (40) ist Gastprofessor für kritische Gesellschaftstheorie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Theorien radikaler Staatskritik.
2017 hat er den Band «Anarchismus zur Einführung» im Junius-Verlag veröffentlicht.