Auf allen Kanälen: Mein Schweizer Freund
Eine Studie bewertet die Integration von Jugendlichen mit einem Ranking der Herkunftsländer: Mediale Zuspitzung? Hanebüchene Wissenschaft?
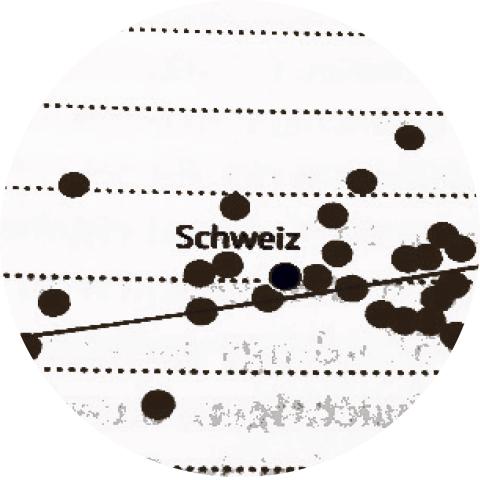
Integration ist vor allem individuelle Anstrengung, so suggeriert es die Schlagzeile der «SonntagsZeitung»: «Wer sich integriert – und wer sich isoliert». Darüber sehen wir eine Rangliste, die in Werten zwischen null und hundert quantifiziert, wie gut integriert Jugendliche mit unterschiedlichem «Migrationshintergrund» in der Schweiz sein sollen: Die ÖsterreicherInnen liegen auf dem ersten Platz (Wert: 83), die MazedonierInnen auf dem letzten (Wert: 55).
Die Rangliste geht auf eine kürzlich publizierte Studie zurück, für die 8300 Jugendliche in der Schweiz befragt wurden, und die «SonntagsZeitung» setzte die Ergebnisse auf der ersten Doppelseite ihres ersten Bundes prominent in Szene. Instrumentalisiert die immer wieder nach rechts schielende Tamedia-Zeitung hier seriöse Forschung, oder liegt das Problem schon beim Absender?
Die Studie stammt von einem Team um den Kriminologen Dirk Baier, der das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften leitet. Baier wird regelmässig in deutschsprachigen Zeitungen und Fernsehsendungen zitiert, vor allem als Experte für Jugendkriminalität. Seine fragwürdige Studie zu Extremismus unter Jugendlichen wurde im letzten Herbst breit diskutiert (siehe WOZ Nr. 46/2018 ); befragt wurden dazu die gleichen 8300 Jugendlichen wie für die Integrationsstudie. Was der Differenzierung nicht unbedingt entgegenkommt, knallt in der Debatte dafür umso mehr: «Schweizer Teenager hassen den Kapitalismus», titelte der «Blick».
Stereotype Interpretation
Wie gut die Jugendlichen integriert sind, will die aktuelle Studie anhand von bloss drei Kriterien beurteilen: wie hoch die Schulbildung ist, wie viele Schweizer FreundInnen die Jugendlichen haben und ob sie sich primär als SchweizerIn identifizieren. Vor allem wegen des ersten Kriteriums kommen die Schweizer Jugendlichen auch nur auf einen Wert von 87. Der in der Studie angewendete Begriff von Integration gehe auf den deutschen Soziologen Hartmut Esser zurück und sei in der Forschung weitverbreitet, sagt Baier. Auch die OECD operiere mit ähnlichen Kriterien.
Das Hauptproblem der Studie sieht Esteban Piñeiro, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz unter anderem zu Migration forscht, beim Fokus auf Nationalitäten, der der «SonntagsZeitung» als Steilvorlage diente: «Dass die Integration gemäss Herkunft ausgewiesen wird, begünstigt eine stereotype und individualisierende Interpretation der Resultate. Das komplexe Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft im Integrationsprozess bleibt unterbelichtet.»
Im Gespräch gibt Studienautor Baier zu, dass die Aufreihung nach Herkunftsland heikel ist. Doch er betont, die Studie könne auch die Diskriminierung bestimmter Gruppen sichtbar machen. «Natürlich kann jemand die Ergebnisse so interpretieren, dass die Mazedonier sich nicht genug anstrengen. Ich würde hingegen fragen, welche Hürden sich dieser Gruppe in den Weg stellen und wie ihre Erfolgschancen verbessert werden können.» Baier nennt etwa Vorurteile oder die Bildung der Eltern.
Dort die Zugewanderten
Allerdings fragt sich: Wenn es bei der Studie eigentlich um strukturelle Diskriminierung geht, wieso untersucht Baier dann nicht einfach diese? Die Ergebnisse seien nur vorläufig und müssten durch weitere Untersuchungen ergänzt werden, so Baier. Doch einen Nutzen der Studie sieht er darin, dass sie zeige, welche Gruppen gefördert werden müssten. «Es ist ja nicht so, dass diese Leute nicht intelligent sind, da liegt ein riesiges Potenzial brach.»
Piñeiro hingegen stellt die Aussagekraft der Studie grundsätzlich infrage. Ihr Integrationsbegriff basiere auf dem Bild einer zweigeteilten Gesellschaft: hier die homogene Mehrheitsgesellschaft, dort die Zugewanderten. «Stattdessen müsste man viel stärker von einer pluralistischen Gesellschaft ausgehen, in der gar nicht mehr eindeutig bestimmt werden kann, was Freunde mit Schweizer Herkunft sind», so Piñeiro.
Die Studie gibt die gesellschaftliche Realität also nicht nur sehr vereinfacht wieder, sie verzerrt sie auch. Der «liberale» Boulevardjournalismus mit provokantem Rechtsdrall kann daraus nur noch abschreiben.