Ein Gemeinwesen für die Zukunft: Gegen das Recht des Stärkeren
In Zeiten zunehmender Überwachung ist Kritik am Staat dringend notwendig. Die Coronapolitik könnte jedoch einen Bruch markieren hin zu einem Staat, der mehr Freiheit bringt.
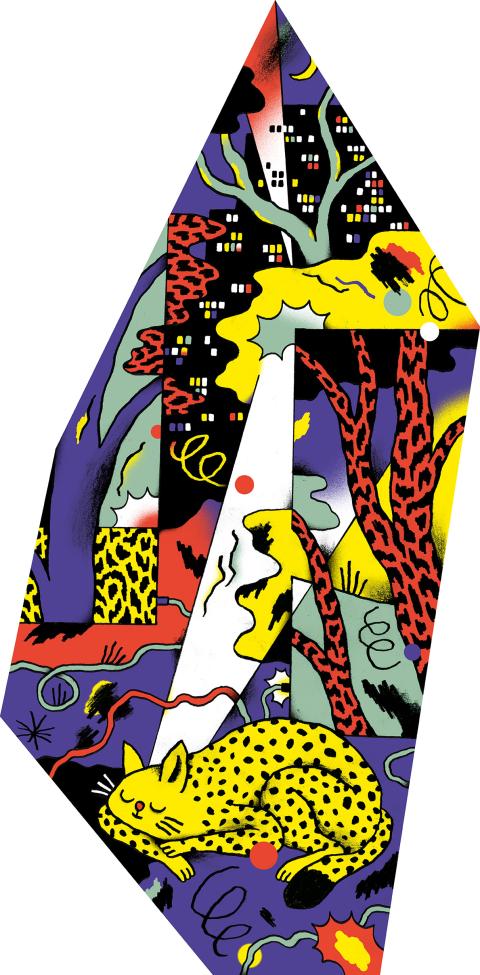
Wer will es leugnen? Das politische Lager jener, die eher progressiv ticken, ist seit der Coronapandemie immer mehr gespalten. Nicht in der Mitte, aber irgendwo am Rand. Die Mehrheit findet Massnahmen wie die Pflicht zur Maske, die Beizenschliessung vergangenen Winter oder die Zertifikatspflicht richtig. Andere verstehen die Welt nicht mehr.
Einige verstehen sie nicht mehr, weil sie Verschwörungstheoretiker:innen auf den Leim gekrochen sind, die behaupten, Fakten zu liefern, die in den «Mainstreammedien» aufgrund irgendwelcher mächtiger Interessen angeblich nicht mehr gesagt werden dürften. Das gilt aber nicht für alle: Andere erkennen dieselben Fakten an, sie interpretieren sie aber anders.
Obwohl selten explizit ausgesprochen, dreht sich der Zwist in erster Linie um den Staat: Die einen sehen dessen Eingriff als demokratisch legitimierten Akt der Solidarität. Die anderen warnen, dass der Staatseingriff in den Autoritarismus führt.
Hinter dieser Warnung steckt das Bild eines Staats, der in erster Linie den Mächtigen dient. Tatsächlich sollte man auch demokratische Staaten nicht verklären. Konzerne haben ihre Drähte in die Regierungen und ihre Leute in den Parlamenten. Seit der neoliberalen Wende der siebziger Jahre sind die Regierungen ihrer Wunschliste weitgehend gefolgt: Öffentlicher Besitz wurde privatisiert, die Länder des Globalen Südens mithilfe etwa des Internationalen Währungsfonds für Konzerne geöffnet; die Steuern wurden gesenkt und der Schutz der Arbeiter:innen geschleift. Davon zeugt die sich überall verschärfende Ungleichheit.
Gleichzeitig haben die Regierungen seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA die Repression und Überwachung verschärft. Es ist der Versuch, die Folgen der Ungleichheit in Schach zu halten: Flüchtende aus dem Süden werden an den Grenzen mit Stacheldraht abgefangen, Proteste wie am G20-Gipfel in Genua 2001 in Gewalt erstickt. Neben Rechtsextremen und Dschihadisten, die die zerrütteten Gesellschaften hervorbringen, werden auch Linke vom Geheimdienst fichiert und Sozialhilfeabhängige ausspioniert.
Es ist eine autoritäre Zementierung sozialer Ungleichheit. Umso erstaunlicher, dass den Neoliberalen noch immer geglaubt wird, sie seien «gegen den Staat».
Und haben nicht auch in der Coronapandemie die Zentralbanken Billionen in die Finanzmärkte geschleust, um Banken und die Aktienvermögen der Reichsten zu retten? Erhielten Konzerne nicht Milliarden für Kurzarbeitsgeld, während sie gleichzeitig mit vollen Händen Dividenden ausschütteten? Und haben Pharmafirmen wie Moderna oder Pfizer mit dem Covid-Impfstoff nicht enorm profitiert?
Ja, doch ist das höchstens die halbe Geschichte. Die Coronamassnahmen markieren vielmehr einen Bruch, der den Weg zu einem neuen Staat frei machen könnte: Als das Coronavirus Anfang 2020 Europa erreichte, war unklar, was die Antworten von rechts und links darauf sein würden. Es war mit Magdalena Martullo-Blocher ausgerechnet eine SVP-Politikerin, die als Erste im Parlament auf die «Freiheit» pochte, eine Maske zu tragen. Das Virus traf in eine ideologische Leere. So folgte der Westen dem Weg, den ihm China mit dem harten Lockdown in Wuhan wies.
Der Einfluss Chinas reicht jedoch viel weiter. Das Reich ist aus der Finanzkrise 2008, die den Westen in die Knie gezwungen hat, als Sieger hervorgegangen. Chinas Rezept ist ein starker Staat, der nicht zögert, auch Techgiganten wie Alibaba an die Leine zu nehmen. Als neuer Konkurrent des Westens wird China gleichzeitig zu dessen Vorbild: So wie Franklin Roosevelt in den dreissiger Jahren mit dem sozialdemokratischen New Deal nicht zuletzt auf die Sowjetunion reagierte, sind die Billioneninvestitionen des heutigen US-Präsidenten Joe Biden in Infrastruktur, Service public und Forschung die Antwort auf Chinas Aufstieg; wie auch die Antwort auf gefährliche Clowns wie Donald Trump, die die auseinanderfallende Gesellschaft insbesondere seit der Finanzkrise von 2008 an die Oberfläche spült.
In den vergangenen Jahrzehnten hatten sich die westlichen Staaten immer mehr darauf beschränkt, mit Schulden die sich verschärfende Ungleichheit etwas zu mildern: Sie senkten den Reichen die Steuern, liehen sich aber stattdessen bei ihnen das Geld, um es den Ärmeren zu geben. Mit China als Vorbild plädieren nun zunehmend auch Liberale für einen Staat, der nicht nur Reiche wieder stärker besteuert, sondern auch Wohlstand schafft. Die britische Ökonomin Mariana Mazzucato etwa lobt das Projekt der US-Mondlandung 1969 in ihrem jüngsten Buch als Vorbild für einen künftigen produktiven Staat.
Auch die Coronapolitik folgt in weiten Teilen diesem neuen Geist: Die Lockdown-Massnahmen waren nicht im Interesse von Konzernen und grossen Investoren. Im Gegenteil: Kaum je haben sich Regierungen derart klar gegen deren Interessen gestellt. Abgesehen von Krisenprofiteuren wie der US-Filmplattform Netflix, haben Konzerne wegen der Massnahmen viel Geld verloren.
Das ist nicht nur an den Dividenden abzulesen, die 2020 zurückgingen. Es zeigt sich auch darin, dass Konzernverbände wie Economiesuisse sehr schnell gegen den Lockdown zu lobbyieren begannen. Sie fürchten um ihre Profite.
Die Lockdown-Massnahmen waren kein Staatseingriff zur Zementierung sozialer Ungleichheit. Im Gegenteil: Sie dienten in erster Linie dem Schutz von gesundheitlich schwächeren Menschen und dem Spitalpersonal, das seit über einem Jahr unter enormer psychischer Belastung Covid-Patient:innen versorgt und manche von ihnen in den Tod begleitet. Und sie tragen dazu bei, dass auch andere weiterhin ein Spitalbett finden. Dasselbe gilt für das öffentliche Impfangebot und die Zertifikatspflicht.
Natürlich profitieren von der Impfung auch Moderna oder Pfizer – wie andere Grosse, die die Wirtschaft am Brummen halten wollten. Doch ist jeder Konsum zugleich auch im Interesse des Produzenten. Der Skandal liegt vielmehr darin, dass Regierungen den Firmen erlaubt haben, die milliardenteure öffentliche Impfforschung mit Patenten zu privatisieren (siehe WOZ Nr. 7/2021 ); und dass Länder wie die Schweiz in der Welthandelsorganisation nun die Patente dieser Firmen verteidigen.
Der Staat griff zudem nicht nur ein, um gesundheitlich, sondern auch sozial Schwächere zu schützen. Nebst den Milliarden, die sich grosse Konzerne nahmen, ging auch viel Geld an Menschen, die es brauchen: Gewerbetreibende, Selbstständige und Angestellte mit kleinen Einkommen – auch wenn etliche durch die teilweise zu groben Maschen fielen. Dass sich viele Staaten dafür so hoch verschulden, wäre vor der Pandemie noch unvorstellbar gewesen. Das Schweizer Parlament schuf gar die Grundlage für eine öffentliche Impfstoffproduktion.
Es haben sich also durchaus auch die Interessen der Schwächeren durchgesetzt. So wie man Demokratien nicht verklären darf, sollte man sie auch nicht verteufeln: Sie folgen nebst den Mächtigen auch dem Druck der Bürger:innen. Dieser Druck kam von Pflegeverbänden, Ökonomen, Epidemiologinnen, Gewerkschaften oder Parteien.
Und der Druck weist in Richtung eines anderen Staats – eines Staats, der nicht nur bereit ist, in die Freiheit der Stärkeren einzugreifen, um die Schwächeren zu schützen, sondern der den Menschen Freiheit ermöglicht, indem er ihnen unter die Arme greift. Ja, Genossenschaften, Vereine oder Nachbarschaften sind dafür ebenso wichtig; der Staat ist jedoch das einzige Instrument, das Stärkere zwingen kann, ihre Freiheit zugunsten Schwächerer einzuschränken.
Natürlich zeigt das Einparteienregime China, wie gefährlich der Staat gleichzeitig für die Freiheit des Einzelnen werden kann. Der Staat muss demokratisch sein. Und: Solange das, was man tut, niemandem schadet, geht dies den Staat nichts an. Dieses Prinzip zu verteidigen, ist gerade in Zeiten der zunehmenden Überwachung dringend.
Ausserdem stellt sich immer die heikle Frage, wie stark die Freiheit der einen zugunsten der anderen eingeschränkt werden darf. So kann zum Beispiel der Lockdown zum Schutz der Gesundheit etwa für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die aus öffentlichen Betreuungsstrukturen fallen, einen gravierenden Einschnitt bedeuten; genauso wie etwa für Kulturschaffende, die ihre Existenzgrundlage verlieren. Es gilt abzuwägen – und alles zu tun, um die Folgen durch mehr finanzielle Umverteilung zumindest abzufedern. In diesem Sinne kann man angesichts der Zertifikatspflicht mit gutem Grund fordern, dass die Tests gratis bleiben müssen.
Allerdings droht der progressive Kampf für die persönliche Freiheit gegen den Staat in eine libertäre Haltung zu kippen: dann nämlich, wenn man die persönliche Freiheit verteidigt, die Freiheit anderer zu verletzen. Ist die Freiheit, sich ohne Test oder Impfung zu bewegen, wirklich wichtiger, als die ungeimpften Kinder vor Covid-Langzeitfolgen zu schützen, genug Spitalbetten freizuhalten, das Gesundheitspersonal zu entlasten und die Pandemie zu verkürzen, damit wir alle unsere früheren Freiheiten wiedererlangen?
Ist das nicht dasselbe wie ein Konzern, der auf möglichst viel Freiheit pocht, auch wenn andere dafür giftige Luft einatmen müssen? Die dringende Staatskritik droht im Zeitalter des Hyperindividualismus oft unbeabsichtigt in ein Plädoyer für das Recht des Stärkeren zu kippen.


