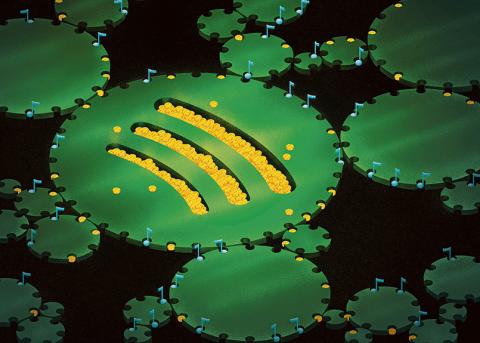Filmgesetz: Lieber Pornos aus Polen
Auch wenn es zum bürgerlichen Mantra gehört, dass es im Leben nichts umsonst gibt: Hier nochmals etwas Gratisnachhilfe für all jene, die sich im Kampf gegen das Filmgesetz laufend blamieren, weil sie so gern mit Begriffen wie «Filmsteuer» und «Subventionen» hantieren. Steuern sind Abgaben an den Staat, Subventionen sind staatliche Fördergelder.
Nichts von beidem steht bei der Änderung des Filmgesetzes zur Debatte. Diese will künftig auch ausländische Privatsender mit Schweizer Werbefenstern (Umsatz: über 300 Millionen Franken pro Jahr) und Streamingdienste dazu verpflichten, vier Prozent ihres hier erzielten Umsatzes in die hiesige Filmwirtschaft zu investieren. Man kann diese «Lex Netflix» einen Investitionszwang nennen, aber wer von einer Steuer spricht: Nachsitzen!
Für Schweizer Privatsender gilt diese Investitionspflicht allerdings schon lange. Der Grundgedanke: Wer in der Schweiz Filme anbietet, soll sich auch an der hiesigen Produktion beteiligen. Wenn Referendumsführer Matthias Müller von den Jungfreisinnigen nun von einem «Systemwechsel» spricht, ist also auch das gelogen. Es sollen jetzt bloss die bestehenden Regeln auf vergleichbare Akteure angewendet werden – vor allem solche, die es bei der letzten Revision vor zwanzig Jahren noch gar nicht gab. Netflix? War damals noch eine Onlinevideothek, die DVDs per Post verschickte.
Heute erzielen Streamingriesen in der Schweiz geschätzt rund 200 Millionen Franken Umsatz pro Jahr – Erträge, die restlos ins Ausland abfliessen. Heisst: Internationale Streamingkonzerne und ausländische Privatsender werden derzeit vom Gesetz gegenüber Schweizer Privaten begünstigt. Nun also hiesiges Gewerbe stärken? Nicht mit SVP, FDP und Gewerbeverband: Alle haben sie die Nein-Parole beschlossen, schützen also lieber die Interessen internationaler Konzerne, die in der Schweiz weder Steuern zahlen noch Arbeitsplätze schaffen. Ebenso die bürgerlichen Jungparteien, die das Referendum ergriffen haben: Unterstützt werden sie dabei, wen wunderts, von den deutschen Privatsendern RTL, Sat 1 und Pro Sieben.
Die hiesige Filmwirtschaft wiederum hat das Nachsehen, weil solche Investitionspflichten für Streamingdienste anderswo längst in Kraft sind – etwa in allen Nachbarländern ausser Österreich. Und das Modell mit vier Prozent Investitionspflicht wäre vergleichsweise liberal: Deutschland etwa verlangt Netflix und Co. zwar nur 2,5 Prozent des Umsatzes ab – aber diese sind als Abgabe direkt an die staatliche Filmförderung zu leisten.
Einen Schönheitsfehler hat das Filmgesetz: dass Streamingdienste künftig mindestens dreissig Prozent europäische Filme anbieten müssten. Eurozentrismus, um die Vormacht der US-Filmindustrie zu bannen? Schwierig. Aber wer deswegen das Märchen vom «staatlichen Filmabend» bemüht, hat das internationale Filmgeschäft nicht begriffen. Denn in den EU-Ländern gilt diese Quote schon jetzt. Und die Streamingriesen werden ihr Angebot nicht extra für den kleinen Schweizer Markt mit asiatischen oder afrikanischen Titeln erweitern.
Für viele ist dieser Abstimmungskampf auch einfach ein willkommener Anlass, wieder einmal ihre Ressentiments gegen das angeblich dürftige Schweizer Filmschaffen abzuladen. Umgekehrt argumentiert auch das Komitee für das Filmgesetz gerne mit Qualität und streicht die jüngsten Erfolge des Schweizer Films heraus. Nur: Qualität ist gar nicht der Punkt. Die Frage, ob Schweizer Filme erfolgreich und/oder speziell hochstehend sind oder nicht, ist für die Abstimmung über das Filmgesetz völlig irrelevant. Auch wenn es in beiden Lagern manchmal so tönt: Netflix ist ein Konzern, kein Gütesiegel. Frühjahr 2020, wir erinnern uns: Über Wochen war der meistgeschaute Film bei Netflix der polnische Softporno «365 Days». Wenn der Algorithmus einen Film nach oben spült, zahlt das Schweizer Publikum offenbar gerne für gestreamten Schrott. Sogar für solchen aus Europa.