Stefanie Sargnagel: «Klar muss man sich über die eigene Szene lustig machen»
Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen könne sie nicht verstehen, dass die Leute ihren Humor verlören, sagt die Wiener Autorin Stefanie Sargnagel. Man müsse nur aufpassen, sich dabei nicht von rechts vereinnahmen zu lassen.
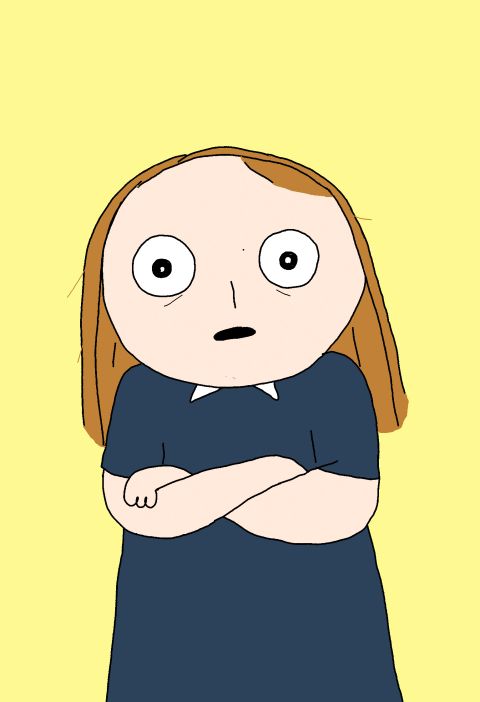
WOZ: Stefanie Sargnagel, in Ihrem neusten Buch, «Iowa», schreiben Sie ausführlich über Ihre Zeit mit der Berliner Musikerin, Schauspielerin und Regisseurin Christiane Rösinger am Grinnell College in Iowa. Im Buch bewundern Sie Rösinger leidenschaftlich dafür, auch heute noch ein Punk zu sein. Was heisst es denn, Punk zu sein?
Stefanie Sargnagel: Christiane ist über sechzig, hat immer noch diesen rotzigen Fickt-euch-alle-Gestus, und es ist überhaupt nicht peinlich. Ich bin ja als junge Künstlerin zu einem gewissen Erfolg gekommen, langsam setzt nun der Alterungsprozess ein. Da habe ich mich schon zu fragen begonnen, ob ich jetzt gewisse Freiheiten verliere, ob ich diesen Antigestus, den ich so kultiviert habe, weiterhin durchziehen kann. Muss ich eine andere Rolle finden, eine richtige Intellektuelle werden, mich besser bilden? Christiane ist für mich in vielem ein Gegenentwurf. Wir sind uns auf eine gewisse Art auch ähnlich, nicht nur, was die Haltung zur Welt angeht. Wir sind beide in eher bildungsfernen Familien aufgewachsen, haben einen ähnlichen Humor, sind sehr stur. Sie hat mir halt zwanzig Jahre voraus: Insofern ist sie auch eine Zukunftsvision von mir selbst, die ich nicht als hängen geblieben empfinde.
In «Iowa» beschreiben Sie, wie Sie sich im Lästern über Reiche finden, andererseits aber auch darin, dass Sie sich über «Klasse» als Modethema lustig machen. Was finden Sie daran problematisch?
Dass es oft ganz tragische Geschichten sind, die erzählt werden. Man muss sicher über Diskriminierungen reden, aber ich mag generell kein Pathos, dieses Leidende, das geht mir schnell auf die Nerven, weil ich es kitschig finde. Wir verarbeiten das auch in Christianes Stück «Die grosse Klassenrevue», in dem ich mitspiele. Diese Geschichten vom Lumpenproletariat, der Vater Alkoholiker, alles schlimm, man hätte so gern zum Bildungsbürgertum gehört, musste sich aber immer verstellen … Da fehlt mir manchmal wiederum ein bisschen der Punk: Warum will man denn da dazugehören, warum will man das nicht lieber sprengen? Bei uns unten ist es dafür nicht so verkrampft, verklemmt und spiessig, es ist lustiger, wenn wir zusammen sind. Aber das Geld, das wollen wir natürlich schon.
Stefanie Sargnagel
Die österreichische Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel (38) wurde durch Statusmeldungen auf Facebook berühmt, in denen sie vor allem ihr Leben als Callcenterangestellte kommentierte. Sie zeichnet Cartoons unter anderem für die Wiener Wochenzeitung «Falter» und ist bis heute auf Social Media aktiv. 2020 erschien ihr erster Roman, «Dicht», über ihre Jugendjahre in Wien.
2022 wurde sie als Gastdozentin ans Grinnell College for Liberal Arts in Iowa eingeladen; während zweier Wochen wurde sie dort von der Berliner Punkikone Christiane Rösinger begleitet. Mit «Iowa. Ein Ausflug nach Amerika» (siehe WOZ Nr. 22/24) erschien 2023 ein Bericht über diese Zeit, von Rösinger mit Fussnoten ergänzt.
Wo sind Rösinger und Sie sich uneinig?
Ich würde sagen, was das Einfühlungsvermögen gegenüber andern Menschen betrifft. Christiane ist viel direkter und ehrlicher als ich, das kann auch sehr lustig sein. Wo ich vorsichtig wäre und sagen würde, hier kann man auch mal Rücksicht nehmen, ist sie eher mal genervt von jemandem und auch wertender als ich.
Sie sagt Ihnen immer wieder, die jungen Leute heute seien harmoniesüchtig. Hat sie recht?
Wahrscheinlich ist man im Alter weniger vorsichtig, man sagt eher, was man braucht, und quält sich nicht mehr so. Aber es kann natürlich auch ein Generationending sein. Ich denke, damals war der Umgang rougher. Meine Generation ist schon reformpädagogischer aufgewachsen, mit Eltern, die sich vielleicht mehr um einen scheren, wo man mit Kindern überhaupt einfühlsamer umgeht. Da hat die Generation davor mehr einstecken müssen an Brutalität. Unsere ist mehr auf die eigenen Befindlichkeiten fokussiert. Man findet schneller mal etwas zu schlimm.
In «Iowa» beschreiben Sie eine Diskussion der Dozent:innen des College in Grinnell zur Frage, ob Student:innen die Möglichkeit haben sollen, anonym Beschwerden über Lehrende einzureichen. Schnell wird über Cancel Culture gesprochen. Wie haben Sie die Auseinandersetzung dort erlebt?
Ich denke, wie die Diskussion dort verlaufen ist, hatte viel damit zu tun, dass sie auf einem teuren Privatcollege stattfand. Wenn das Studieren dort ein Vermögen kostet, muss man den Leuten irgendwas bieten. Wenn an der öffentlichen Uni in Wien von Student:innen geklagt würde, im Philosophiestudium seien zu viele weisse Männer vertreten, würde es kaum ein solches Entgegenkommen geben.
Die Kritik greift, weil viel Geld im Spiel ist?
Ja, und auch, weil es ein Liberal Arts College ist, das Gleichberechtigung und Mitsprache verspricht. An christlichen oder sonst wie autoritäreren Colleges ist das sicher anders. Das College in Grinnell schreibt sich auf die Fahnen, progressiv zu sein, es hat eine gewisse Geschichte der Protestkultur, es will woke sein, und andererseits kann man sichs auch nicht leisten, in einer privaten Institution mit internationalem Ansehen autoritär drüberzufahren. Soziale Sanktionen bekommen dadurch mehr Gewicht. In Europa kenne ich solche Diskussionen weniger im institutionellen Rahmen, höchstens vielleicht an einer Kunstuni. Ansonsten eher aus linken Szenen.
Wie nehmen Sie die Diskussionen dort wahr?
Man hat in antiautoritären Szenen oft den Grundsatz, dass alle mitreden können, und versucht, jede Stimme zu hören – aber insgeheim gehen einem die Leute total auf die Nerven, und man denkt sich, die sollen sich mal zusammenreissen. Trotzdem versuchst du, niemanden zu diskriminieren. Und da gibts halt oft ein paar wenige, die das als Ausrede nehmen, um besonders viel Aufmerksamkeit abzuzweigen und besonders viel Zuwendung einzufordern, weil sie sich als marginalisiert sehen, obwohl es eh meistens alles Akademikerkinder sind. Das ist anstrengend, wenn sich Konflikte so zuspitzen.
Was meinen Sie mit zuspitzen?
Wenn man zum Beispiel den Gewaltbegriff so verwäscht, dass jede andere Meinung, jede Widerrede als Gewalt empfunden wird, und das dann als emotionale Manipulation eingesetzt wird – und das gegenüber Leuten, die sich vielleicht eh bemühen, möglichst gerecht und umgänglich mit andern umzugehen, in subkulturellen Szenen, die eh prekär sind. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun: Wenn die Leute irgendwann Kinder haben und Vierzigstundenjobs, bleibt wenig Energie, um sich gegenseitig in irgendwelchen Subkulturszenen zu schikanieren. Da hat man doch vielleicht andere Erfahrungen, die eigenen Eltern werden krank, Leute sterben, es gibt plötzlich die harten Eingriffe im Leben, wo man diese i-Tüpfel-Reiterei auch nicht mehr so ernst nehmen kann.
Sie bringen diese Kritik auch immer wieder in den sozialen Medien auf. Wird diese Position nicht schnell von rechts vereinnahmt?
Das ist das Dilemma an dem Ganzen. Praktisch jede linke Person, mit der man unter vier Augen redet, sagt mal einen Satz wie «Man darf ja gar nichts mehr sagen», auch wenn man das eigentlich nicht will, weil man dann klingt wie die alten Männer, die einmal in ihrem Leben Kritik erfahren. Es ist alles ein bisschen differenzierter in echt, nicht so schwarzweiss. Man kann diese Tendenz kritisieren und trotzdem kritikfähig sein; man kann auch nach einem Fehltritt in den sozialen Medien, der hysterisch aufgebauscht wird, immer noch kritikfähig sein. Abseits von Social Media gibt es zum Glück viele Diskussionsräume, wo die Leute gnädiger und differenzierter sind, sich normaler streiten.
Beeinflussen Sie diese Überlegungen dabei, was Sie auf Social Media veröffentlichen und was eher nicht?
Schon. Früher hat mich fast ausschliesslich ein eher linkes, hippes Publikum gelesen, da konnte ich gut denen den Spiegel vorhalten. Als ich bekannter wurde, hat mich auch mal ein rechtes Magazin zitiert, weil ich mich über Linke lustig gemacht habe. Das will ich sicher nicht, also muss ich mich fragen, inwieweit sich das lohnt. Andererseits finde ich es blöd, wenn man sich deswegen zensiert, denn natürlich muss man sich auch über die eigene Szene lustig machen. Man muss sich über alles lustig machen.
Angesichts der Weltlage sagen manche, sie würden langsam den Humor verlieren. Können Sie das nachvollziehen?
Solche Aussagen find ich immer schwierig, das ist so ein bisschen, wie wenn man sagt, ich weiss nicht, wie gutes Essen möglich sein soll oder Sichverlieben möglich sein soll. Humor ist oft eine Bewältigungsstrategie im Sinne eines Spannungsabbaus: Je stressiger und je schlimmer etwas ist, desto mehr braucht es das.
Eine andere Überlebensstrategie, die in Ihrer Arbeit immer auch mitschwingt, ist, sich zu verweigern.
Ich finds grundsätzlich einen guten Antrieb, das Gegenteil von dem zu machen, was die Leute erwarten. Auf der Bühne etwa oder auch im Umgang mit der Zuschreibung, die ich als Künstlerin bekomme … solange es nicht ultradestruktiv wird.
Wann wird es destruktiv?
Na ja, wenn ich jetzt aufstehe und einfach die Bierflasche vom Tisch schlage, nur weil ich kann und weil es unerwartet wäre oder ein cooler Effekt, mach ichs halt doch nicht. Weils einfach scheisse wär.

