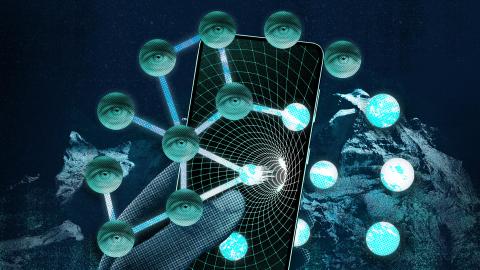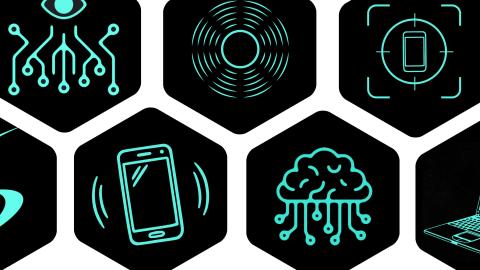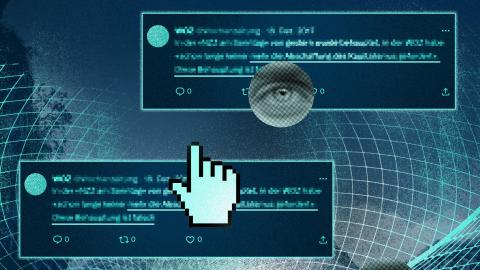Schmutzige Transaktionen: Der skrupellose Gigant
Unter dem Titel «Dirty Payments» hat sich die WOZ mit zwanzig internationalen Partnermedien zusammengeschlossen, um die illegalen Geschäfte hinter dem Onlinezahlungsriesen Worldline offenzulegen.
Es war der verheerendste Kurssturz in der Geschichte des französischen Leitindex CAC 40: Am 25. Oktober 2023 senkte Worldline, Europas zweitgrösster Zahlungsdienstleister, seine Gewinnprognose – worauf die Aktie an einem Tag um 59 Prozent einbrach. Kurz darauf flog der Konzern aus dem Index.
Hinter dem Börsenfiasko verbirgt sich einer der grössten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte in Europa. Die internationale Recherche «Dirty Payments» unter der Koordination des Netzwerks EIC (European Investigative Collaborations) hat vertrauliche Dokumente des Finanzdienstleisters Worldline ausgewertet, die dem EIC zugespielt worden waren. So wurde erstmals belegt, dass Worldline über ein Jahrzehnt hinweg Transaktionen in Milliardenhöhe aus dubiosen Quellen abgewickelt hat – etwa für illegale Casinos, Pornoportale, Escortseiten und sonstige Branchen mit hohem Risiko für Betrug und Geldwäsche. Die ausgewerteten vertraulichen Dokumente legen nahe, dass der Konzern von den teilweise illegalen Machenschaften seiner Kunden wusste – doch er schaute weg, missachtete regulatorische Pflichten und machte sich so zum Komplizen. Worldline tat alles, um Gewinne und Aktienkurse hochzutreiben, ohne Rücksicht auf verwerfliche und illegale Geschäftsmodelle mit Tausenden Geschädigten weltweit.
Der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, zählt Worldline zu den zentralen Akteuren der europäischen Wirtschaft. Über Kassenterminals und Websites verarbeitet das Unternehmen jährlich Kartenzahlungen im Wert von rund 500 Milliarden Euro. Auch in der Schweiz ist Worldline über die Tochterfirma Worldline Schweiz AG Marktführerin bei der Zahlungsabwicklung.
Entsprechend eng ist die Verbindung zur hiesigen Finanzinfrastruktur: 2018 verkaufte die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group ihr Kartengeschäft an Worldline und liess sich grösstenteils in Aktien auszahlen. So gehörten der SIX Group zwischenzeitlich 27 Prozent des französischen Finanzgiganten. Nach einer schrittweisen Reduzierung hält die SIX Group, die neben der schweizerischen auch die spanische Börse betreibt, heute noch einen Anteil von 10,5 Prozent – womit sie die grösste Einzelaktionärin bleibt.
Im Mutterkonzern selbst mischen derweil die obersten Etagen der französischen Machtelite mit: So präsidierte der frühere französische Wirtschaftsminister Thierry Breton bis zu seiner Ernennung zum EU-Kommissar 2019 dessen Verwaltungsrat. Doch hinter der glatten Oberfläche internationaler Finanzarchitektur verbirgt sich ein zu grossen Teilen durch und durch schmutziges Geschäftsmodell.
«Verkaufen, verkaufen, verkaufen»
Zum Verständnis: Während gewöhnliche Onlinehändler ihren Finanzdienstleistern meist weniger als fünf Prozent Transaktionsgebühr zahlen, entrichteten über 950 im Rahmen von «Dirty Payments» identifizierte Händler deutlich mehr – mindestens 350 von ihnen gar über zehn Prozent. Ein verlässlicher Hinweis auf illegale Geschäfte. Offenbar ist das Business derart lukrativ, dass Worldline 2014 – kurz nach der Abspaltung vom französischen IT-Konzern Atos – bei seiner belgischen Tochterfirma eigens eine Abteilung einrichtete, um gezielt Händler in sogenannten Hochrisikobereichen anzuwerben.
Bis 2020 zählte diese Abteilung bereits über 3000 Kunden. Im März desselben Jahres lag deren Betrugsquote – also die Anzahl von Geldrückforderungen von Kund:innen im Verhältnis zu den getätigten Transaktionen – bei eineinhalb Prozent und war damit doppelt so hoch, wie die Quote, die etwa der Zahlungsdienstleister Visa toleriert. Doch statt gegenzusteuern, beförderte der Konzern den Abteilungsleiter zum globalen E-Commerce-Chef und startete im Juni 2021 die Umsatzoffensive «Projekt Funke». Deren Ziel: Umsatzverdopplung binnen vier Jahren – mit Fokus auf Hochrisikohändler, insbesondere Onlinecasinos, obwohl diese in Frankreich strikt verboten sind.
Eine Schlüsselrolle in diesem Geschäftsmodell spielte die von Worldline 2022 übernommene deutsche Tochter Payone. Deren rasanter Aufstieg und jäher Absturz erinnern an den Skandal um den deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard im Jahr 2020. Schon im ersten Jahr nach der Übernahme wurde bekannt, dass Payone mit mindestens 311 verdächtigen Händlern zusammenarbeitete. Eine Bank monierte «unzureichende Überwachung». Dennoch wurde der CEO von Payone, der Schweizer Niklaus Santschi, im September 2022 zum Chef der Division «Händlerdienstleistungen» des Mutterkonzerns befördert. Das Geschäft war offensichtlich schlicht zu profitabel. In einem internen E-Mail vom März 2023 verkündete Santschi sein Motto «Verkaufen, verkaufen, verkaufen» zusammen mit der Botschaft «Rentabilität und Cash sind König!». Gleichzeitig schwächte er gezielt die Compliance-Abteilung: Sie sollte künftig «Wachstum ermöglichen», statt es zu bremsen. Rund ein Dutzend erfahrene Compliance-Angestellte wurden entlassen, versetzt, oder sie gingen von selbst.
Und so kam es, wie es kommen musste. Eine interne Prüfung vom Juni 2023 brachte hervor, dass Payone-Kunden über 1700 Websites betrieben, die gezielt Internetnutzer:innen abzockten. Zudem bestanden nachweislich Verbindungen zu kriminellen Netzwerken. Das Muster war derart auffällig, dass die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Payone als «Komplizin» einstufte. Denn Worldline wusste davon – doch die Risikoabteilung erhielt per E-Mail die Anweisung, dies gegenüber Visa, Mastercard und Regulierungsbehörden zu verschweigen, mit dem Hinweis: «Diese Gruppen existieren rechtlich nicht – also darf Worldline nicht wissen, dass sie existieren.»
Im Juli 2023 verhängte die Bafin eine Strafe gegen Payone wegen Verstössen gegen Betrugs- und Geldwäschereiregeln. Eine Stellungnahme lehnte Worldline auf Anfrage ab – man sei ein «börsennotiertes Unternehmen» und könne keine «vertraulichen Informationen» preisgeben oder Kundenbeziehungen kommentieren. Und weiter: «Worldline verpflichtet sich, die höchsten Standards in Sachen Compliance und Bekämpfung von Finanzkriminalität einzuhalten.»
Offiziell alles sauber
Laut internen Zahlen aus dem Jahr 2023 wickelten allein die 1300 «schmutzigsten» Kunden in Deutschland und Belgien im letzten Jahr vor ihrem Rauswurf Transaktionen im Umfang von mindestens 800 Millionen Euro ab. Das lässt auf Zahlungen in Milliardenhöhe schliessen, die Worldline seit 2014 für fragwürdige Akteure getätigt hat. Diese waren so profitabel, dass ihr Wegfall die Bilanz des Konzerns enorm belastete. Resultat war die Gewinnwarnung vom 25. Oktober 2023 – und der Absturz der Aktie.
Am Ende zahlten die Beschäftigten die Zeche: 1400 Stellen fielen einem Sparprogramm zum Opfer. Ex-Payone-Chef Niklaus Santschi sowie Worldline-CEO Gilles Grapinet mussten 2024 ebenfalls gehen. Andere zentrale Akteure des betrügerischen Zahlungssystems sind weiterhin im Amt.
Offiziell ist bei Worldline seit 2024 alles sauber. Auf Anfrage versichert das Unternehmen, man habe inzwischen eine «Betrugsrate unter dem Branchendurchschnitt». Doch die Recherchen von «Dirty Payments» zeichnen ein anderes Bild: Die Aktivität im Hochrisikosegment bleibt beträchtlich. Allein 2024 wickelte Worldline laut internen Zahlen zwölf Milliarden Euro in diesem Bereich ab – darunter drei Milliarden für Glücksspielseiten und zwei Milliarden für Angebote aus dem sogenannten Erwachsenenbereich. Derweil hat die Unternehmensführung im Rahmen des erwähnten Sparprogramms in Europa erneut Dutzende Stellen in den Abteilungen für Risiko und Compliance gestrichen.
Nachtrag vom 3. Juli 2025: Worldline: Kurssturz nach Grossrecherche
Dieser internationale Effort hat seine Wirkung nicht verfehlt: Kaum waren die Ergebnisse der «Dirty Payments»-Recherche letzte Woche publiziert, sackte der Börsenwert von Worldline, dem zweitgrössten Zahlungs- und Transaktionsdienstleister Europas, um satte vierzig Prozent ab – innert eines Tages. Die WOZ hatte gemeinsam mit zwanzig internationalen Partnermedien unter der Koordination des Netzwerks European Investigative Collaborations (EIC) die fragwürdigen Geschäfte des Konzerns mit Sitz in Frankreich aufgedeckt. Nebst unethischen Geschäftspraktiken kann diesem auch die Missachtung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei in mehreren Ländern vorgeworfen werden.
In Deutschland wurde die Tochterfirma Payone bereits 2023 wegen Verstössen gegen Betrugs- und Geldwäschereiregeln gebüsst. Am Freitag nun hat auch die Brüsseler Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen die belgische Niederlassung eingeleitet. In Schweden reagierte die Finanzaufsicht mit einer Vorladung des dortigen CEOs auf die Enthüllungen – eine offizielle Untersuchung ist nicht ausgeschlossen.
Bereits im Herbst 2023 ist der Worldline-Kurs abrupt um 59 Prozent abgestürzt – es war der heftigste Tagesverlust in der Geschichte des französischen Leitindex CAC 40. Die Konzernführung schob das Debakel damals auf ein «deutlich schwierigeres makroökonomisches Umfeld». Heute aber ist klar: Das war gelogen. Die Aufsichtsbehörden in Belgien und Deutschland hatten den Finanzriesen damals gezwungen, die Geschäftsbeziehungen zu einem Grossteil seiner «schmutzigen», aber äusserst profitablen Kunden zu kappen. Das riss ein gewaltiges Loch in die Bilanz – und zwang den Konzern zu einer Korrektur der Gewinnprognose, was den rekordhohen Kurssturz zur Folge hatte.
Seit dem Höchststand 2021 hat die Worldline-Aktie rund 95 Prozent ihres Wertes eingebüsst. Besonders schmerzhaft ist das für die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group, die mit einem Anteil von 10,5 Prozent die grösste Einzelaktionärin des Konzerns ist. Es ist kaum zu erwarten, dass die nächsten Kapitel in dieser Affäre dem Aktienkurs besser bekommen werden.