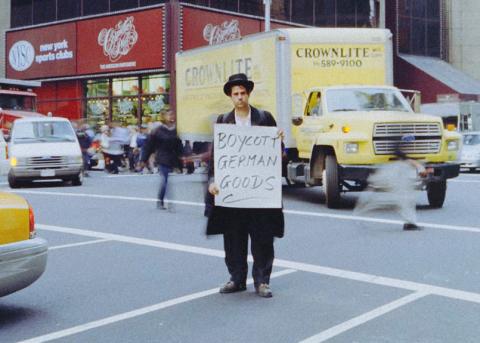Robert Wilson (1941–2025): Er nahm das Bild beim Wort
Wie stehen die Chancen, dass ein schwuler Junge aus einer religiösen Familie in Texas, geboren kurz vor Kriegseintritt der USA, zu einem der wichtigsten Regisseure des Welttheaters avanciert? Wie um Himmels willen konnte so einer, der in der Schule stotterte, über die anarchische Downtown-Szene im New York der sechziger Jahre in den Kunstolymp finden?
Die Antwort liegt wie so oft bei den Lehrpersonen, die sofort etwas erkennen. Byrd Hoffman war schon achtzig, als sie dem jungen Robert Wilson zeigte, wie er langsam atmen und die Energie fliessen lassen muss, damit er nicht bei jedem Wort anstösst. Hoffmans Therapie beschreibt bereits den Kern von Wilsons Ästhetik: die Dinge künstlich verlangsamen, streng rhythmisieren, um zu einer ungeahnten Freiheit zu gelangen – sei es des flüssigen Sprechens, sei es des Spielens ohne das Korsett von Text und Naturalismus, wie es das Theater nicht nur in den USA nach wie vor verlangt.
Man muss also die weiss geschminkten Gesichter und die Schlaghölzer, die Szenen unterteilen, in Wilsons «Hamletmaschine» von Heiner Müller 1986 als Versuch sehen, sich von der Last des monströsen Textes zu befreien. So fliessen die Assoziationen, die Performer:innen werden von der verschwitzten Psychologie und vom druckvollen Sprechen befreit. Im Prinzip sind das auch Mittel der historischen Avantgarden vor dem Krieg, die ohne Wilson vielleicht vergessen wären.
Wilson hat die therapeutische Seite von Kunst stets weitergegeben. In Texas, später in New York arbeitete er mit kognitiv eingeschränkten Menschen oder solchen mit Hirnverletzungen. In den Sechzigern adoptierte er einen Schwarzen gehörlosen Jungen, als er sah, wie diesem Polizeigewalt widerfuhr. 1970/71 trat dann dieser Raymond Andrews in «Deafman Glance» auf, der Produktion, mit der Wilson durchstartete.
«Einstein on the Beach» mit Philipp Glass, die oft nachgespielten High-Art-Musicals in Hamburg wie «Black Rider» mit der Musik von Tom Waits, die Wagner-Opern an den grössten Häusern: Wilsons Kunst war rasch zu erkennen, sie sah mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entstehung für manche gelackt aus. Und wenn wie in «Einstein» ein Leuchtbalken in der Horizontalen während zehn Minuten in die Diagonale gehoben wird, ähnelt das Bild dem Logo der Deutschen Bank. Aber in der Herkunft dieser Ästhetik versteht man erst, warum Wilson die konventionelle Theaterkunst erweitert hat wie keiner in den letzten fünfzig Jahren. Nun ist Robert Wilson nach kurzer Krankheit 83-jährig in New York gestorben.