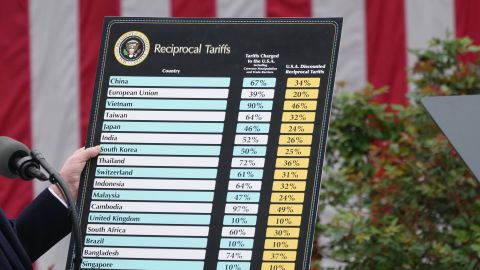USA: Trumps liberale Komplizen
Längst nicht nur die radikale Rechte hat sich hinter Donald Trump versammelt. Widerstand gegen seinen Umbau der USA kommt vor allem noch von unten.
Stellen wir uns kurz vor, die Wahl Donald Trumps hätte einen umfassenden institutionellen Widerstand in den USA ausgelöst. Stellen wir uns vor, die grössten Firmen und Organisationen des Landes würden sich der Kooperation verweigern. Das Oberste Gericht würde die verfassungswidrigen Präsidialverfügungen konsequent als solche verurteilen. Die Demokratische Partei würde geschlossen kämpfen.
Könnte Trump in diesem Szenario sein Programm trotzdem durchsetzen? Teilweise schon. Die Macht, die im Weissen Haus liegt, ist gross. Wäre er mit seinem Umbau von Staat und Gesellschaft so weit gekommen, wie er bislang gekommen ist? Sicherlich nicht. Dafür braucht es Mitläufer, Einknickende, Opportunistinnen.
Nach den ersten sieben Monaten seiner zweiten Präsidentschaft muss man festhalten, dass Trump längst nicht nur die Republikanische Partei und andere explizit rechte Kräfte hinter sich hat. Zu viele Konzerne, die vor ein paar Jahren noch die Regenbogenflagge hissten, machen heute den reaktionären Backlash mit. Zu oft übernehmen liberale Zeitungen und Sender das Framing von Trump; als ginge es etwa bei den Kürzungen des Sozialstaats um die Bekämpfung von «Verschwendung, Betrug und Missbrauch», wie propagiert wird, und nicht um knallharte Austerität und um Klassenkampf von oben.
Museen verändern in vorauseilendem Gehorsam ihr Programm. Die Demokratische Partei klemmt, abgesehen von manchen Ausnahmen, zwischen Träg- und Feigheit fest. Unter dem Strich ist auf die sogenannte liberale Mitte genauso wenig Verlass wie auf das oft idealisierte «Checks and Balances»-System. Dass der Supreme Court Trumps Rachefeldzug nur sehr bedingt aufhält, wundert kaum.
Die «grosse Kapitulation», wie es in der «New York Times» hiess, bahnte sich schnell nach der Wahl an. Techgrössen wie Mark Zuckerberg (Meta) und Sam Altman (Open AI) verkündeten im Dezember, für Trumps Amtseinweihung jeweils eine Million Dollar zu spenden. Apple-CEO Tim Cook und Google schlossen sich an. Elon Musk war sowieso schon Team Maga. Bei der Amtseinführung sass das Silicon Valley dann auch in der ersten Reihe, wirkte weniger kapitulierend, vielmehr Chancen witternd. Und Trump? Der freute sich über den offenkundigen Vibeshift. «In der ersten Amtszeit haben mich alle bekämpft», sagte er. «In dieser Amtszeit wollen alle meine Freunde sein.»
Trump kann sich auf Techkonzerne wie Palantir und Amazon verlassen, die der Abschiebebehörde ICE digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen. Etliche Unternehmen sind zudem der Vorgabe gefolgt, Diversitätsprogramme zu beenden, darunter Disney, Pepsi oder Roche. Mehrere Anwaltsfirmen haben mit der Regierung abgemacht, kostenlose Rechtsberatung im Wert Hunderter Millionen Dollar zu leisten. All diesen Entscheidungen ging gewiss Druck voraus. Doch gezwungen zur Komplizenschaft ist in der Privatwirtschaft niemand. In vielen Fällen setzen sich Geld- und Machtinteresse schlichtweg gegen Integrität durch.
Besonders düster ist die Unterwerfung im Fall von Organisationen, die – mal naiv gedacht – Hüter dieser Integrität sein sollten. Ein Beispiel ist Paramount, das Mutterunternehmen des Nachrichtensenders CBS News. Weil Paramount-Chefin Shari Redstone ihren Konzern verkaufen wollte und dabei die Zustimmung der Regierung benötigte, liess sie sich in einem eigentlich unverlierbaren Streit auf einen aussergerichtlichen Vergleich samt Millionenzahlung für Trump ein. Nachdem CBS-Late-Night-Moderator Stephen Colbert dieses Manöver kritisiert hatte, wurde kurzerhand die Absetzung seiner Show bekannt gegeben.
Auch die Arrangements zwischen verschiedenen Universitäten und der Regierung sprechen Bände. Während Trump allzu offensichtlich Antisemitismusvorwürfe instrumentalisiert, um Dissens und ungeliebte Forschung zu unterdrücken, spielen einige Eliteunis das Spiel mit – die Columbia University etwa verpflichtete sich zu einer Zahlung von 221 Millionen Dollar Bussgeld und zur Einschränkung von Diversitätsmassnahmen. Andere Unis haben sich auf ähnliche Vereinbarungen eingelassen. Widerstand dagegen zeigen vor allem die Studierenden. Die Opposition gegen Trump kommt in den USA allermeist von unten.