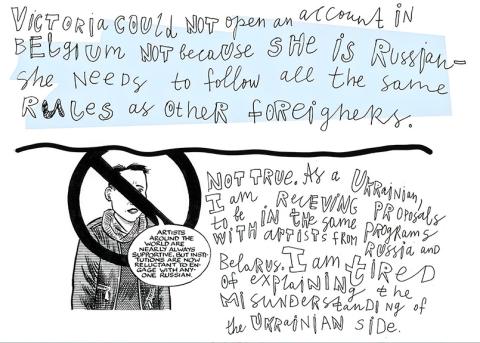An Norwegens Grenze: Umkämpftes Gedenken
In der östlichsten Stadt Norwegens will der Bürgermeister sowjetische Denkmäler abreissen lassen, um Russlands Einfluss zu schwächen. Doch Bewohner:innen bangen um die Erinnerung an ihre Vorfahren.

Drei schneeweisse Radarkugeln thronen auf einem Hügel am arktischen Ozean, darunter bunte Holzhäuser. Die Luft ist kristallklar, die Konturen der felsigen Landschaft gestochen scharf. Nur ein Schiffshorn durchdringt das Möwengeschrei. Einmal pro Tag legt hier am Hafen von Vardø auf der Insel Vardøya ein Hurtigruten-Schiff an und lädt eine Schar von Tourist:innen ab. Für sie mag es ein beliebiger Stopp auf ihrer Arktisreise sein. Doch die Insel ist von strategischer Bedeutung.
Das norwegische Vardø im Verwaltungsbezirk Finnmark ist der letzte Stopp vor Russland. Die weissen Kuppeln wirken deplatziert in der Ödnis. Offiziell orten sie Weltraumschrott. Expert:innen halten sie jedoch für einen Teil der Nato-Infrastruktur, die russische Raketen überwachen soll. Unweit von hier schlummern Russlands atomar bewaffnete U-Boote in der Barentssee. Von der Halbinsel Kola in der russischen Arktis starten Bomber in Richtung Ukraine. Im Fischerdorf Vardø ist der Alltag untrennbar mit geopolitischen Spannungen verwoben.
Bürgermeister Tor-Erik Labahå von der Zentrumspartei weiss um sie. Er wartet vor dem Rathaus und fängt mit einer offiziellen Begrüssung an. «So kenne ich das aus dem Arbeitsalltag», sagt er lachend. Sein bisheriges Arbeitsleben hat er in der norwegischen Verteidigung verbracht. «Der hybride Krieg eskaliert in dieser Region», sagt er. Dabei gebe es etwas, das ihm besonders grosse Sorgen bereite. Es ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg.
Zahlreiche neue Denkmäler
Russland berührt eine schmerzhafte Wunde der nordnorwegischen Bevölkerung: die Geschichte der Partisan:innen. Etwa fünfzig bis siebzig Norweger:innen flohen 1940, nach der Besetzung Norwegens durch die Deutschen, in die Sowjetunion. Dort wurden sie für den Kampf gegen die Nazis ausgebildet und halfen später bei der Befreiung der östlichen Finnmark. Während des Kalten Krieges stigmatisierte Oslo sie jedoch als Kommunist:innen und überwachte sie jahrzehntelang. 1992 bat König Harald zwar um Entschuldigung. Doch in Vardø wirkt dieses Trauma bis in die Gegenwart nach, viele Nachkommen leben hier.
Im hohen Norden

Zahlreiche Denkmäler erinnern heute an die sowjetischen Befreier:innen. Insbesondere seit der Annexion der Krim 2014 mischt sich Russland jedoch verstärkt ein: In Zusammenarbeit mit Beamt:innen in Murmansk und dem russischen Generalkonsulat in Kirkenes entstanden zusätzliche Denkmäler, die an die Partisan:innen und an sowjetische Pilot:innen erinnern. Bis 2020 gab es Gedenkfahrten von Murmansk nach Vardø. «Patriotische Filmfestivals» zeigten in Nordnorwegen russische Kriegsfilme. Die Botschaft dahinter: Russland erkenne die schmerzhafte Geschichte der Partisan:innen an. Den Angriff auf die Ukraine stellt der Kreml dabei als Fortsetzung der heldenhaften Taten im Zweiten Weltkrieg dar. Und zeichnet ein Bild, auf dem die Nordnorweger:innen auf seiner Seite stehen.
«Wir wissen, wo die norwegisch-russische Grenze verläuft», sagt Labahå. «Bei unserem Gegenüber bin ich mir nicht sicher.» Präsident Wladimir Putin hat geschworen, Russland zur dominierenden Macht in der Arktis zu machen. Bürgermeister Labahå will seinen Teil dafür tun, ihn zu stoppen, und will die neu errichteten Denkmäler abreissen lassen. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Aussenministeriums, richtete sich im August in einer Stellungnahme an Labahå: «Sympathisierst du mit den Nazis, Hitler und der SS? So sieht es nämlich aus.» Das russische Generalkonsulat in Kirkenes liess eine Anfrage der WOZ zur russischen Erinnerungspolitik in Nordnorwegen unbeantwortet.
Grenzübergreifende Wettkämpfe
Hinter den dunkelblauen Gardinen in Labahås Arbeitszimmer breitet sich die glitzernde Barentssee in der Nachmittagssonne aus. Der Bürgermeister hält die arktische Idylle für alles andere als friedlich. Hier, wenige Meter von der Grenze entfernt, steuerten 2017 und 2018 russische Kampfjets das Radarsystem von Vardø an, um den Angriff zu proben. «Die Menschen in Vardø sind an die besondere Lage auf der Weltkarte gewöhnt», sagt Labahå. Stolz zählt er auf, wie sich seine Gemeinde auf den Ernstfall vorbereitet. Es gibt Schutzräume für alle und genug Vorräte, um jedes Kind sechs Monate lang mit einer Mahlzeit pro Tag zu versorgen, sowie ein Boot mit Starlink-Verbindung, um im Notfall mit der Regierung in Oslo kommunizieren zu können.
Und das, obwohl die Region jahrzehntelang auf enge Kooperation mit Russland setzte. Es gab grenzübergreifende Skiwettkämpfe und Spezialvisa für Menschen, die in Grenznähe lebten. Norweger:innen fuhren nach Russland, um günstig zu tanken. Russ:innen kamen nach Norwegen, um in den dortigen Shoppingmalls einkaufen zu gehen.
In der Nähe des Hafens lässt eine Frau Mitte fünfzig ihren alten Mercedes von einem Freund reparieren. Auf die Frage, wie es sich hier lebe, mit Norweger:innen, Russ:innen, die insbesondere in den neunziger Jahren herüberkamen, und seit 2022 auch geflüchteten Ukrainer:innen, lacht sie. «Wir leben auf einer Insel am Ende der Welt. Hier muss man sich vertragen.» Dass sie sich nicht direkt auf die Seite der Ukraine gestellt habe, müsse man ihr nachsehen. «Wir haben eine besondere Geschichte mit Russland.»
Ihr Freund, der über dem Steuer lehnt und jetzt den ratternden Motor testet, sagt, er vermisse seine russischen Fischerfreunde aus Murmansk, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion massenhaft über die Grenze kamen. «Nur das GPS-Jamming nervt», sagt er. Russland sendet seit mehr als drei Jahren Störsignale. Seitdem verirren sich Fischer:innen im Nebel, Rettungshelikopter geraten in Schwierigkeiten. Nordnorwegen gilt als Testfeld für russische Einflussnahme.
Verneigung und Angriff
Ein Anruf bei der Arktischen Universität in Tromsø. Die Historikerin Kari Aga Myklebost hat Studien veröffentlicht, die zeigen, dass Russland die Geschichte nutzt, um politischen Einfluss in Nordnorwegen zu gewinnen. Der russische Aussenminister Sergei Lawrow kam 2014 und sogar noch 2019 zu Gedenkfeiern für den Zweiten Weltkrieg nach Kirkenes, da war die Krim längst russisch annektiert. «Die Gedenkfeiern waren politisch umstritten», erinnert sich Myklebost. «Dennoch bestand die Öffentlichkeit in Nordnorwegen auf diese hochrangigen Feierlichkeiten. Sogar die norwegische Regierung wurde in die Veranstaltungen einbezogen.»
Ebenfalls 2019 reisten Anhänger:innen der Junarmija, der russischen Jugendarmee, nach Nordnorwegen. In kakifarbenen Uniformen posierten die Kinder am 75. Jahrestag der Befreiung der Finnmark vor einem riesigen hölzernen Kreuz in Vardø. Die Junarmija liefert Nachschub für die russische Front. In den besetzten Gebieten der Ukraine treibt sie die russisch-patriotische Umerziehung ukrainischer Kinder voran. Myklebost sagt, der Kreml wolle durch gemeinsame Gedenkveranstaltungen zeigen, dass die Menschen in Nordnorwegen im Krieg gegen die Ukraine angeblich auf Russlands Seite stehen: «Seit 2014 wurden Daten aus dem russischen Militärkalender systematisch nach Nordnorwegen exportiert.»
Am 23. Februar 2022, dem russischen Tag des Verteidigers des Vaterlands, verbeugten sich der russische Botschafter in Norwegen, Teimuras Ramischwili, und der Generalkonsul Nikolai Konygin vor dem sowjetischen Befreiungsdenkmal in Kirkenes. In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages flogen die ersten Raketen auf Kyjiw. Die propagandistische Rechtfertigung des Kreml: Man kämpfe gegen den europäischen Faschismus. So wie vor achtzig Jahren.
Norwegen hat sich unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine den EU-Sanktionen angeschlossen. Laut dem Geheimdienst gilt Russland seit 2022 als Hauptbedrohung für die nationale Sicherheit. Historikerin Myklebost hält das Land für besonders verwundbar. «Wir haben eine lange Tradition gemeinsamen Gedenkens. Es ist für russische Akteure einfach, zu argumentieren, dass der Krieg das nicht zerstören dürfe.» Als sie ihre Recherchen zum ersten Mal veröffentlicht habe, seien einige Menschen in Vardø verärgert gewesen. «Sie wollten nicht hören, dass ihre schmerzhaften Familienerinnerungen ausgenutzt wurden.»
«Lernen, kritisch zu sein»
Etwa eine halbe Stunde von Vardø entfernt liegt Vadsø, ein weiteres Fischerdorf. Der Bus fährt am dunkelblauen Ozean vorbei, am Horizont ragen Felsspitzen in den Himmel. Unten der Strand, oben eine Reihe kleiner Holzhäuser. In einem von ihnen lebt Christina Jorstad, 32 Jahre alt. Sie ist Geschichtslehrerin am Gymnasium. Als Kind hat ihre Grossmutter ihr von der deutschen Besatzung erzählt. Von den Bomben, die auf das Fischerdorf fielen. Jorstad steigen die Tränen in die Augen. «Es muss schrecklich gewesen sein.» Heute erzählt sie ihren Schüler:innen von ihrer Grossmutter – und von den Partisan:innen.
«Natürlich wollen wir nicht für einen propagandistischen Staat missbraucht werden», sagt Jorstad. «Aber ich verstehe auch, warum die Entfernung der Denkmäler für Angehörige der Partisan:innen schwierig sein kann.» Im August fand im Museum in Vardø eine Veranstaltung zum Thema statt. Auch Jorstad war dort. Die Diskussion war hitzig. Einige fühlten sich von den klaren Worten des Bürgermeisters überrannt, sie fürchten ein erneutes Schweigen über die Geschichte der Partisan:innen. Andere fühlen sich fälschlicherweise der Zusammenarbeit mit Russland beschuldigt.
«Wir Geschichtslehrer:innen sind unsicher, wie wir zum geplanten Abriss der Denkmäler stehen», sagt Jorstad. «Irgendjemand wird die Geschichte immer für seine eigenen Interessen ausnutzen. Das Wichtigste ist, dass wir lernen, kritisch zu sein.» Sie zeigt ihren Schüler:innen die Recherchen von Myklebost, verweist auf das Partisan:innenmuseum in Vardø und Gedenkstätten, die von Norwegen errichtet wurden. «Der Weg, die Geschichte der Partisan:innen am Leben zu halten, ist, dass wir sie weiterhin in der Schule unterrichten.»