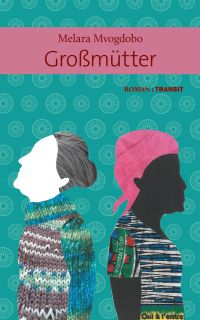Literatur: Süsse Früchte des Widerstands
Melara Mvogdobos «Grossmütter» erzählt von der späten, aber radikalen Befreiung zweier Frauen. Bevor er für den Schweizer Buchpreis nominiert wurde, fand der Roman kaum Beachtung.
Diese Geschichte beginnt am Ende: «Der Tod kommt von unten. Er hat sich über meine Füsse Einlass verschafft und kriecht jetzt langsam, […] unbeirrt aufwärts.» Wie der Tod, der zuerst an ihren Zehen kitzelt, um irgendwann den ganzen Körper zu erfassen, drängt sich im Roman von Melara Mvogdobo die Wut immer mehr ins Bewusstsein der Protagonistinnen.
Die Schweizer Autorin lässt zwei Frauen in ihren Achtzigern unabhängig voneinander ihre Leben Revue passieren – Leben, die durch ihr Dasein als Frauen in patriarchalen und misogynen Gesellschaften bestimmt sind, bis sie sich mit der Beseitigung ihrer Ehemänner daraus befreien. Aber «Grossmütter», der zweite Roman Mvogdobos, ist auch eine Würdigung des steten Tropfens, der leisen Aufstände, die in der Summe Veränderungen herbeiführen.
Bis zum Nein der Männer
Dabei könnten die Ausgangslagen der beiden um 1940 geborenen Protagonistinnen unterschiedlicher nicht sein. Genau wie der Regen an den Handlungsorten des Romans: In Kamerun hat er «einen Anfang und ein Ende», in der Schweiz hingegen «steht man morgens mit demselben Regen auf, mit dem man sich abends wieder ins Bett legt». Die eine Figur wächst in Kamerun in Reichtum auf, die andere in einer ärmlichen Bauernfamilie in der Schweiz. Trotz ökonomischer, geografischer und kultureller Differenzen stossen sie an dieselben Glasdecken – «Träume sind auch kein Mädchenzeugs», weiss die Schweizerin. Bildung ist zweitrangig, und dass die Kamerunerin Ärztin, die Schweizerin Pflegefachfrau werden möchte, interessiert nicht. Ob die beiden Frauen überhaupt heiraten und Kinder kriegen wollen, erst recht nicht.
Ihr vorbestimmtes Leben als Frauen ihrer Generation und die latent lodernde patriarchale Gewalt der Männer in ihren Leben, sei es von Vätern, Knechten oder Ehemännern, eint sie. Ihre Freiheit «reicht nur bis zum nächsten Nein eines Mannes», heisst es einmal. Sie selbst dürfen nicht Subjekt sein, das wird auch dadurch veranschaulicht, dass die Hauptfiguren namenlos bleiben. Im Wechsel erzählen sie in knappen Vignetten von den Wendepunkten in ihren Leben – ein gelungener literarischer Effekt: En passant treten dadurch die vielen Übereinstimmungen der Biografien hervor, wenn es um die Stellung der Frauen geht. Gerade weil die Protagonistinnen aus der Ich-Perspektive erzählen, sind sie besonders zu Beginn nur mit Mühe auseinanderzuhalten. Durch die Austauschbarkeit der Stimmen entlarvt Mvogdobo die Unterdrückung von Frauen in patriarchalen Gesellschaften als strukturell, jenseits von individuellen Umständen.
Melara Mvogdobo, 1972 in Luzern geboren, lebte mehrere Jahre in Kamerun und heute mit ihrer Familie in Andalusien. «Grossmütter», bereits im März erschienen, erhält nun Aufwind, weil Mvogdobo damit zwischen Schwergewichten wie Dorothee Elmiger und Jonas Lüscher auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis steht. Davor hat diese Neuerscheinung in den Schweizer Medien nur am Rand stattgefunden. An der Qualität oder der Aktualität des schmalen, im Berliner Transit-Verlag erschienenen Büchleins liegt es auf jeden Fall nicht.
Befreiende Wut
Mit Emanzipation und weiblicher Wut hat sich Mvogdobo bereits in ihrem Debüt beschäftigt. Der Titel «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden» war dort Programm, die Rache am missbrauchenden Vater das Motiv der Hauptfiguren. Die Diskussion um weibliche Wut als feministischen Antrieb greift Mvogdobo auch in «Grossmütter» wieder auf und erinnert damit auch an Widerstandsromane wie Mareike Fallwickls «Die Wut, die bleibt». Der aktuelle Text erzählt allerdings nicht primär von angestauter Wut, die sich in Racheakten entlädt, sondern von leisen Widerständen und einer späten, aber radikalen Befreiung.
Dass sich «Grossmütter» trotz der drückenden Ungerechtigkeit und Gewalt leicht liest, liegt nicht nur an der klaren Sprache, sondern vor allem auch an den leisen Auflehnungen, die der aufkeimenden Verzweiflung beim Lesen etwas entgegensetzen. Das beginnt bei der Mutter der Kamerunerin, die ihre Tochter vor der Hochzeit anfleht, trotz gesellschaftlicher Häme die Polygamie abzulehnen. Es führt über die «leicht nach unten gerichteten Mundwinkel», die die Schweizerin im Spiegel entdeckt und die von ihrer Unzufriedenheit zeugen. Und es erstreckt sich hin zur aktiven Entscheidung, die «schrecklichen Taten unserer Eltern» nicht zu wiederholen.
Mvogdobo erzählt vom zarten Aufblühen widerständiger Gedanken, die den Erdbeeren ähneln, die die Schweizerin so mag: «Sie wachsen im Verborgenen, dicht am Boden.» Der Geschmack der Beeren ist dann «so wunderbar süss und lieblich», dass sie dafür eine allergische Reaktion in Kauf nimmt. Die Protagonistinnen lehnen sich auf, mal in vielen kleinen Akten, mal in radikalen Gesten. Bis die vielen Fragen der Enkelin aufs Grosi bald widerspenstig wirken.