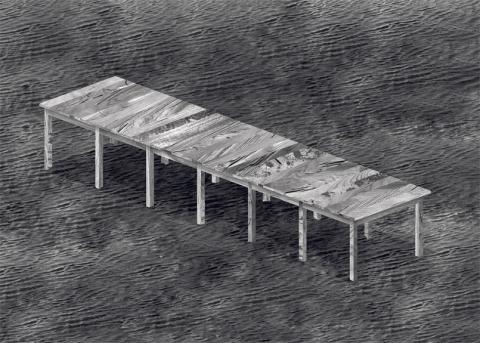Spiritual Care: «Mich motiviert es, dass ich nicht ewig hier bin»
Theologieprofessorin Isabelle Noth bildet Menschen weiter, die Schwerkranke betreuen. Sie ärgert sich über seichte Ego-Spiritualität, erlebt sprachlose Linke und glaubt, dass die Konfrontation mit dem Sterben Kraft geben kann.

WOZ: Isabelle Noth, wie würden Sie gern sterben?
Isabelle Noth: Möglichst schmerzlos natürlich. Und es wäre schön, wenn meine Partnerin dabei wäre.
Kann man objektiv sagen, was ein guter Tod ist?
Nein. Die Bedürfnisse sind so unterschiedlich. Die meisten Leute möchten daheim sterben. Aber nur etwa ein Viertel tut es wirklich. Wenn es so weit ist, ist man oft gottenfroh, wenn man ins Spital kann und von Fachleuten unterstützt wird. Viele unterschätzen, was daheim sterben bedeutet: Es kann ein unglaublicher Kraftakt für einen selbst wie auch für die Angehörigen sein, wenn sie nicht dafür ausgebildet sind.
Viele Leute sind empört über die hohen Coronatodeszahlen. Sie auch?
Das ist für mich nicht der richtige Ausdruck – empört bin ich, wenn ich lese, dass im Mittelmeer wieder 200 Menschen ertrunken sind, und man schaut weg, lässt das richtiggehend zu. Das empört mich: wie unterschiedlich Tod gewichtet wird. Trotzdem ist es erschreckend, dass so viele Menschen an Corona sterben. Jeder, der stirbt, unabhängig vom Alter, löst enorm viel Leiden aus. Deshalb muss man alle Leben so gut schützen wie möglich. Aber die Folgen von harten Coronamassnahmen wie psychische Störungen, Armut, mehr sexualisierte Gewalt müssen auch bedacht werden. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss.
Verdrängen wir den Tod jetzt weniger als vor Corona?
Der Tod ist ja überall gegenwärtig – aber in einer merkwürdig distanzierten, domestizierten Form: in den Nachrichten und in Krimis. Was wir gern von uns wegschieben, auch jetzt noch, ist der eigene Tod. Das ist verständlich – wie wollten wir leben, wenn er dauernd präsent wäre? Es gibt religiöse Praktiken, die dem Ziel dienen, sich der eigenen Vergänglichkeit immer wieder bewusst zu werden. Aber mit Pausen. Sonst hält man das ja nicht aus.
Es gab und gibt aber doch schon Kulturen, wo der Tod viel präsenter ist – zum Beispiel in Mexiko, wo man an Allerheiligen den Kindern Totenköpfe aus Zucker schenkt …
Europa kennt die Tradition von Totentänzen und Memento-mori-Literatur. Aber das alles passt kaum zu unserem heutigen naturwissenschaftlich-technokratischen Gesundheitswesen. Da ist der Tod der Feind, den es zu besiegen gilt.
Wenn er nicht mehr der Feind wäre, was könnte er dann sein?
Etwas, das zu uns gehört und aus dem man Freiheit gewinnen kann. Die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, so brutal sie manchmal ist, hilft mir, das Leben entschiedener zu führen: Wer bin ich, was will ich, wofür stehe ich ein? Das kann enorm Kraft geben. Mich motiviert es zu wissen, dass ich nicht ewig hier bin. Meine Zeit ist kostbar, die verplempere ich nicht. Wenn ich weiss, dass ich sterbe, hat es auch keinen Sinn, zum Beispiel Geld zu horten, wenn es Leute gibt, die es jetzt dringend brauchen.
Das Bewusstsein vom Tod könnte mehr Gerechtigkeit ins Leben bringen?
Eindeutig. Wir sterben! Das relativiert die Dinge doch.
Es gibt ja die Idee, dass man sterben lernen könne. Glauben Sie das?
Ich bin zurückhaltend, was eine solche Pädagogisierung des Sterbens anbelangt. Aber klar, mit zunehmendem Alter muss man mehr loslassen, geschehen lassen, weil man häufig mehr Hilfe braucht. In einer Gesellschaft, in der es immer darum geht, autonom zu sein, nur ja nicht abhängig zu werden, ist es lehrreich zu erfahren, dass mein Menschsein nicht darauf beruht, wie fit, erfolgreich oder schön ich bin. Man redet ja oft vom würdigen Sterben. Das finde ich schauerlich. Es mag einen unwürdigen Umgang mit Sterbenden geben, aber es gibt kein unwürdiges Sterben. Wenn ich meine Schuhbändel nicht mehr binden kann, nicht mehr weiss, wie ich heisse, wenn ich inkontinent bin, heisst das doch nicht, dass ich unwürdig bin! Würde hängt nicht von einem gesundheitlichen oder mentalen Zustand ab. Jeder Mensch hat Würde. Und Tiere im Übrigen genauso.
Sie haben den Berner CAS-Lehrgang Spiritual Care initiiert. Geht es dabei vor allem um eine philosophische Auseinandersetzung, oder ist der Lehrgang praktisch orientiert?
Dazu muss ich zuerst etwas sagen. Das Thema Spiritualität ist ja in den letzten Jahrzehnten enorm aufgekommen. Viele sagen: Ich bin nicht religiös, aber spirituell. Es kommt zum Teil so seicht daher! Als Nabelschau, ohne jeden politischen Impetus. Auch in Grosskonzernen dürfen sich die Angestellten jetzt ein bisschen mit Spiritualität beschäftigen … Man schafft es, bei der Ruag zu arbeiten und nebenbei ein bisschen zu meditieren und spirituell zu sein.
Das haben die Christen doch auch geschafft.
Aber am Anfang durften sich Soldaten nicht taufen lassen! Die sogenannte Jesusbewegung war enorm gesellschaftskritisch. Diese naive Spiritualitätsverzweckung für das persönliche Glück, ohne Bezug zur Weltsituation, hat mich einfach geärgert. Und dann kamen diese Kurse, die einer noch weitgehend patriarchalen Medizin ein spirituelles Mäntelchen umhängen. Jetzt soll der Arzt ein «spiritual assessment» und ein «spiritual screening» durchführen. Mit Fragebogen! Ich hoffe, dass die Leute den Mut haben, dem Arzt zu sagen: «Wissen Sie was? Das geht Sie nichts an!»
Was machen Sie denn anders in Ihrem Lehrgang?
Wir wollen den aktuellen Stand der Spiritualitätsforschung vermitteln. Da geht es etwa um Traumaforschung, Resilienzforschung, religionspsychologische Erkenntnisse oder Sterbebegleitung. Es ist keine primär praktisch orientierte Weiterbildung. Aber die Teilnehmenden sind ja berufstätig, haben ihr Praxisfeld und Fallbesprechungen und können einbringen, was sie gelernt haben: in der Pflege, in der Psychotherapie, in der Medizin. Sie werden sensibilisiert für die Bedeutung von Spiritualität im Heilungsprozess und für ihre Relevanz etwa im Umgang mit Schicksalsschlägen. Sie lernen, religiös-spirituelle Bedürfnisse von Menschen zu erkennen und welche Möglichkeiten sich als hilfreich erwiesen haben, sie aufzunehmen. Sie lernen aber auch, auf krank machende Formen spiritueller Praxis und die Menschenbilder zu achten, die ihnen zugrunde liegen, und sie machtkritisch zu hinterfragen. Entscheidend für unseren Studiengang ist, dass drei Fakultäten – die medizinische, die philosophisch-humanwissenschaftliche und die theologische – auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Wenn eine schwer kranke Person glaubt: «Jesus schaut zu mir, das kommt schon gut», hilft das, oder?
Da müssen wir genau hinschauen. Es gibt die sogenannte Erwartungshaltung, die kann Menschen bestärken zum Guten hin. Aber wehe, wenn es dann nicht besser, sondern nur schlechter wird! Dann interpretiert die gleiche Person: Jesus liebt mich nicht, weil ich etwas Schlimmes gemacht habe. Dann wirds noch schlimmer. Das sind keine lebensförderlichen Formen von Religion und Spiritualität.
Wie definieren Sie «lebensförderlich»?
Alles, was Menschen hilft, liebevoller, grosszügiger und einfühlsamer zu werden, und ihnen ein tieferes Verständnis für sich und ihre Mitmenschen ermöglicht. Was ihnen hilft, ein bisschen freier zu werden. «Ihr seid zur Freiheit berufen», heisst es in der Bibel, Galater 5,1. Das ist ein Kernsatz. Wir sind nicht dazu bestimmt, in der Angst zu verharren.
In linken Kreisen sind religiöse und spirituelle Fragen oft ein grosses Tabu.
Ja. Ich zähle mich auch klar zur Linken, und ich erlebe dort oft eine grosse Sprachlosigkeit. Es ist kein Bezug da, wie man solche Inhalte formulieren, ausdrücken könnte – eine Art Analphabetismus. Die Bedürfnisse wären schon da, aber die Sprache fehlt. Und durch das Nichtkennen entstehen auch Angst und Abwehr. Es braucht immer noch viel Aufklärung: Manche meinen, wenn in der Bibel steht, die Welt sei in sieben Tagen erschaffen worden, sei das wörtlich gemeint. Religionen wollen aber nicht primär empirische Aussagen machen, sondern Deutungen, Bedeutungen und Orientierung zur Verfügung stellen.
Isabelle Noth (53) ist Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik an der Universität Bern. Sie hat den CAS-Lehrgang Spiritual Care mit ins Leben gerufen und präsidiert ihn.