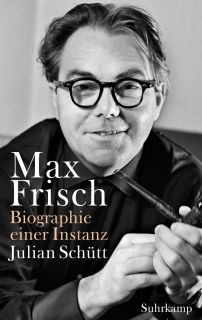Max Frisch: Ein Leben als politische und moralische Instanz
Julian Schütts Frisch-Biografie ist ein unverzichtbares Dokument – nicht nur zum Jahrhundertschriftsteller, sondern zur gesamten Epoche.
«Ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr: man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen.» Was sofort auffällt: wie gut sich viele Frisch-Texte bis heute halten. Seine vielleicht meistzitierten Sätze sind so aktuell wie vor sechzig Jahren.
Im zweiten Band seiner Frisch-Biografie zeichnet der Literaturredaktor Julian Schütt auf rund 700 Seiten nach, welch prägende, heute kaum mehr vorstellbare Präsenz dieser Autor über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit markierte. Mit «Max Frisch. Biographie einer Instanz, 1955–1991» legt er 34 Jahre nach dessen Tod die brillant geschriebene und geschickt komponierte Geschichte eines Menschen vor, der zur moralischen und politischen Instanz vieler seiner Leser:innen geworden und literarische Leitfigur für manche:n seiner schreibenden Kolleg:innen geblieben ist.
Schütt folgt dem Genre gemäss der Chronologie, wechselt aber fliessend zwischen biografischen Fakten und Erläuterungen zu den zeitgleich entstehenden Werken und deren Rezeption. Der erste Teil der Biografie endet 1954, als Frisch mit dem Roman «Stiller» – für Schütt «der Roman der Nachkriegszeit schlechthin» – der internationale Durchbruch gelingt. Um Frischs zweite Lebenshälfte schildern zu können – die von zahllosen Preisen, enormen Buch- und Theatererfolgen mit teilweise horrenden Auflagen und grosser internationaler Resonanz (begleitet auch von einigen Kontroversen) gezeichnet war –, hat Schütt klugerweise gewartet, bis zuvor gesperrte Zeugnisse freigegeben und publiziert wurden. So konnte er nun buchstäblich alle verfügbaren Quellen auswerten, darunter Frischs Briefwechsel (etwa mit Ingeborg Bachmann), Teile des Berlin-Journals aus den 1970er Jahren und Frischs «Entwürfe zu einem dritten Tagebuch» von 1982.
Meister der Fragen und Zweifel
Den «Schnittpunkt von Frischs Literatur und Biographie» sieht Julian Schütt in der Frage, «wie man am Leben bleibt». In der Literatur verlangt dieses «lebendig Bleiben», thematisch und formal stets Neues zu wagen, sich nicht zu wiederholen. Frischs drei grosse Romane «Stiller» (1954), «Homo Faber» (1957) und «Mein Name sei Gantenbein» (1964) sind grundverschieden angelegt, wie auch seine beiden späten Werke «Montauk» (1975) und «Der Mensch erscheint im Holozän» (1979). Beim Ringen um Innovation begleiten ihn oft hartnäckige Selbstzweifel. Schütt zeichnet das an den Beispielen von «Homo Faber» und «Der Mensch erscheint im Holozän» nach: Beide hatte der Autor mehrfach verworfen, zurückgezogen und dann neu geschrieben.
Älter werdend, sah sich Frisch früh mit Langeweile und Einsamkeit konfrontiert. «Ich schüttle Sätze, wie man eine kaputte Uhr schüttelt, und nehme sie auseinander: darüber vergeht die Zeit, die sie nicht anzeigt», heisst es im dritten Tagebuch. Wirklich zufrieden war er schliesslich – trotz aller Zweifel – mit seiner Erzählung «Der Mensch erscheint im Holozän», die während einer Unwetterwoche im Tessin spielt und – hochaktuell – die Klimadebatte mit den Themen Altern und Selbstverlust verbindet. Im deutschen Sprachraum erst verhalten aufgenommen, wurde dieses Werk in den USA ein Riesenerfolg, 1980 zum «Buch des Jahres» gekürt und im «New Yorker» vorabgedruckt.
Zu Frischs besten Texten zählen zweifellos seine «Fragebögen». Im zweiten «Tagebuch 1966–1971» zur Meisterschaft gebracht, bringen sie auch heutige Leser:innen ins Grübeln, Schwitzen und Schmunzeln. «Schreiben heisst sich selber lesen», hatte Frisch schon im ersten «Tagebuch 1946–1949» notiert, und Julian Schütt ergänzt zu Recht: «Frisch lesen heisst eben auch: uns selber lesen. Wir gelangen über seine verarbeiteten Erfahrungen zur Verarbeitung eigener Erfahrungen.» Das ist wohl ein Schlüssel zur immensen Wirkung dieses Autors.
Lebendig bleiben hiess für Frisch im Alltag, sich und seine Beziehungen hartnäckig zu hinterfragen, auch sich selbst zu entkommen. «Ich will doch nicht ein Leben lang dieser Max Frisch sein», sagte er 1961. In den 36 Jahren Berichtszeit, den der zweite Band der Biografie abdeckt, richtete er mehr als ein halbes Dutzend Wohnstätten ein, in Männedorf und Uetikon am Zürichsee, in Berzona im Onsernonetal, in Rom, Berlin, New York und schliesslich, bis zu seinem Tod 1991, in Zürich.
Glanz und Elend
Frischs unablässige Suche nach Neuanfängen prägte auch seine Beziehungen. Nach der Trennung von der ersten Ehefrau, Gertrud von Meyenburg, pflegte er enge Verhältnisse zu Madeleine Seigner-Besson, Ingeborg Bachmann, Marianne Oellers (mit der er 1968 bis 1979 verheiratet war), Alice Locke-Carey (die die Figur von Lynn in «Montauk» inspirierte) und zuletzt zu Karin Pilliod, Tochter von Madeleine Seigner-Besson und Inspiration für die Figur der Sabeth in «Homo Faber». Mit der Publikation des Briefwechsels Bachmann – Frisch wurde das einseitige Bild von Macho Max und Opfer Ingeborg korrigiert, die tragische Dimension dieser wohl intensivsten Liebes- und Eifersuchtserfahrung der beiden deutlich.
Frisch, der früh mit Alters- und Versagensängsten konfrontiert war, blieb zeitlebens stets extrem angewiesen auf ein Gegenüber, ein Du. Ausser Madeleine Seigner-Besson waren alle Gefährtinnen deutlich jünger als er. Julian Schütt schildert Glanz und Elend dieser Paargeschichten akribisch genau, eingeschlossen Frischs gefürchtete Wutanfälle und Phasen mit Alkoholmissbrauch. «Ich falle mir schwer, dafür können die anderen nichts», schrieb Frisch, der sich als Autor sah, «dem Schreiben noch eher gelingt als das Leben».
Frisch als Zeitgenosse
Frisch zweifelte zwar an einer unmittelbar politischen Wirkung der Literatur, entfachte freilich mit Stücken wie «Andorra» (1958, in seinen Worten «ein Judenstück für Nichtjuden», das die Fragen stelle: «Wie kann das anfangen?», «Wie kommt es so weit?») oder «Biedermann und die Brandstifter» (1961) breite Debatten. Im Mai 1970 sass er mit dem damals wohl mächtigsten Mann im Westen, US-Aussenminister Henry Kissinger, zusammen (und porträtierte ihn im zweiten Tagebuch schonungslos); er reiste mit dem deutschen SPD-Kanzler Helmut Schmidt nach China und wurde von ihm in der Krise des Deutschen Herbsts – zusammen mit Heinrich Böll und Siegfried Lenz – im Oktober 1977 in den «Kanzlerbungalow» eingeladen. Seine stark beachtete Rede «Wir hoffen», die er anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1976 hielt, nötigte selbst den Bundesrat zu einem Glückwunsch. Frisch traf Bundesrat Hans Hürlimann; Willi Ritschard wurde zum Freund.
Trotz spürbarer Skepsis und elegischer Resignation im Alter (die Solothurner Rede 1986: «Am Ende der Aufklärung steht das Goldene Kalb») trieben die Abstimmung zur Armeeabschaffung 1989 und die Fichenaffäre 1990 den Autor noch einmal hinter die Schreibmaschine. Vielfalt, Originalität und sprachliche Prägnanz seiner Interventionen in gesellschaftliche und politische Debatten fehlen der heutigen Schweiz empfindlich. Und sie machen Julian Schütts Biografie zu einem unverzichtbaren Dokument nicht nur zu Max Frisch, sondern zur gesamten Epoche.