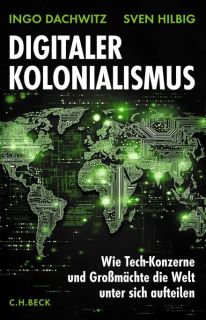Digitaler Imperialismus: Das neue Gewand der Ausbeutung
Techkonzerne üben mit Daten und Algorithmen Macht aus und befeuern ein digitales Wettrüsten, das vor allem zulasten des Globalen Südens geht.

Wie war das noch mal mit der grossen Erzählung von der digitalen Revolution als Demokratisierungs- und Entwicklungsmaschine, dank der auch der Globale Süden zu den Industriestaaten des Nordens wird aufschliessen können? Mit dem Mantra von «AI will fix it» – die KI wirds schon richten – als Update? Wenn der Techjournalist Ingo Dachwitz und der Globalisierungsexperte Sven Hilbig dieses längst hohl gewordene Versprechen erneut aufrufen, dann als rhetorische Steilvorlage, um es in ihrem Buch «Digitaler Kolonialismus» ein für alle Mal zu dekonstruieren.
Man liest sie atemlos, ihre Punkt-für-Punkt-Abrechnung, in deren Verlauf sie eine stringente Gegenerzählung aufbauen: Der Kolonialismus wirkt bis heute fort – in strukturellen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen, geschaffen in Eroberungszügen von neuen, ungleich mächtigeren Kolonialherren. Sie führen keine Staaten, sondern Konzerne und haben innert kürzester Zeit mithilfe von Daten, digitalen Diensten und künstlicher Intelligenz globale Imperien aufgebaut, die sich jeglicher demokratischen Kontrolle entziehen.
Vieles davon ist nicht grundsätzlich neu. Aber Dachwitz und Hilbig nehmen in ihrer Analyse nicht nur das Agieren von Big Tech aus den USA ins Visier, sondern auch deren Konkurrenz aus China, die mit staatlicher Rückendeckung in Afrika operiert. Und sie werfen ein Schlaglicht auf die unrühmliche Rolle, die das rohstoffarme Europa in dieser neokolonialen Dynamik spielt. Dass sie dabei ihre privilegierte Position als weisse Männer aus dem Norden mitreflektieren und auf die Kompetenz von Stimmen aus dem Süden setzen, ist über weite Strecken ein Gewinn.
Neue Formen der Versklavung
Ursprung und Treiber des digitalen Kolonialismus ist der «Ressourcenfluch» vieler Länder Afrikas. Techkonzerne und die geopolitischen Grossmächte hinter ihnen ringen in einem gnadenlosen Wettlauf um den Zugang zu den strategischen Rohstoffen der Digitalisierung, die sich namentlich in der Demokratischen Republik Kongo, einem der weltweit ärmsten Länder, konzentrieren: Kobalt, Kupfer, Seltene Erden, Nickel, Wolfram, Gallium, Germanium und Lithium. Zum neokolonialen Muster gehören dabei vor allem die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur, nicht nur beim Abbau. Sämtliche Aufbereitungs- und Verarbeitungsschritte bis zum digitalen Endprodukt finden im industrialisierten Norden statt, wohin auch alle Profite fliessen.
Dabei ist die Wertschöpfungskette so komplex, dass sich alle Involvierten, vom Rohstoffkonzern Glencore bis zum iPhone-Verkäufer Apple, aus der Verantwortung stehlen können; Apple hat bezeichnenderweise nicht mal einen Laden in Afrika. Dorthin zurück fliesst nur der Abfall der Digitalisierung: Elektroschrott, der sich auf gigantischen Müllhalden – wie jener am Rand von Ghanas Hauptstadt Accra – türmt, auf denen laut Schätzungen der WHO weltweit mehr als dreissig Millionen Frauen und Kinder unter toxischen Bedingungen wiederverwertbare Rohstoffe herauslösen.
Toxisch ist die moderne Sklav:innenarbeit auch in jenen Fabrikhallen, wie sie in Nairobi, Kampala und anderswo stehen, wo Heere junger «Geisterarbeiter:innen» für Subunternehmer von US-Techkonzernen wie Meta im Akkord digitalen Müll von deren Plattformen aussortieren und dabei mit dem traumatisierenden Inhalt (Vergewaltigungen, Kindesmissbrauch, Folter, Hinrichtungen …) alleingelassen, ja mittels Knebelverträgen zum Schweigen verpflichtet werden. Dass die Mehrheit dieser «content moderators» einen akademischen Abschluss, meist im technisch-mathematischen Bereich, besitzen und total überqualifiziert sind, ist eine weitere Folge des falschen Entwicklungsversprechens. Und natürlich hat auch Meta kein einziges Büro in Afrika, die Profite werden im Norden abgeschöpft.
Technik als Herrschaftsinstrument
Kolonialer Logik aus historischer Zeit folgen auch die digitalen Infrastrukturprojekte zum Anschluss Afrikas an die Blutbahnen des Netzwerks, durch das die globalen Datenströme fliessen. US-Techkonzerne gehörten zu den Ersten, die in den 2010er Jahren im grossen Stil Unterseedatenkabel verlegten, Meta (damals noch Facebook) verschaffte zu Beginn gar über 25 Ländern des Globalen Südens gratis Zugang zum Internet – was zur kostenlosen Grundversorgung gehörte, bestimmte indes der Konzern, und gratis ist auch die längst nicht mehr. Mittlerweile sind über siebzig Prozent aller Unterseeleitungen in den Händen westlicher Techkonzerne, die mit der Verfügungsgewalt über diese kritische Infrastruktur ein enormes Machtpotenzial besitzen. Und der digitale Nord-Süd-Graben ist seither sogar noch gewachsen: Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Afrikas kann sich auch heute keine vernünftige Internetverbindung leisten.
China investiert im Rahmen seines Projekts «Neue Seidenstrasse» in Afrika derweil nicht allein in Seekabel, sondern auch in andere Formen digitaler Infrastruktur, von Glasfasernetzen, Mobilfunk und Rechenzentren bis hin zu elektronischen Handelsplattformen und Smart Cities. Bezahlen lässt es sich – klassisch kolonialistisch – mit Rohstoffen für die Digitalisierung, die chinesische Konzerne vor Ort abbauen und zur Weiterverarbeitung nach China abtransportieren; und mit Daten, die es zum geostrategischen Ausbau seiner Macht über den Kontinent nutzt, ihn so finanziell, technologisch und letztlich auch politisch von sich abhängig macht. Denn integriert in die digitale Infrastruktur von Techfirmen wie Huawei ist eine Überwachungstechnologie, die auch vor Spionage bis in höchste Regierungskreise nicht zurückschreckt: Wie 2018 bekannt wurde, flossen jahrelang regelmässig Daten abgehörter Gespräche zwischen Ministern und Staatsoberhäuptern vom Hauptsitz der Afrikanischen Union in Addis Abeba nach Schanghai.
Daten, so machen Dachwitz und Hilbig deutlich, sind «koloniales Herrschaftswissen», ihre Automatisierung und KI sind entsprechend «zu Algorithmen geronnene koloniale Macht». Und diese Algorithmen funktionieren keineswegs neutral, sie weisen diskriminierende Schlagseiten auf, die auf rassistische und sexistische Stereotype der Trainingsdaten zurückzuführen sind. Stereotype, die bereits im Kategorisierungswahn der historischen Kolonialmächte angelegt waren, einem «kolonialen Essentialismus», der bis heute nachwirkt und die versprochene Demokratisierung durch das Internet in ihr Gegenteil verkehrt.
Der Arabische Frühling Anfang der zehner Jahre sei für viele diktatorische Regimes ein Weckruf gewesen. Seither rüsten sie digital auf, operieren mit Netzsperren, digitaler Propaganda, kaufen Cyberwaffen und Überwachungstechnologie – mit tatkräftiger Unterstützung westlicher Techkonzerne: libertäre Rhetorik im Norden, Handlanger für Zensur bis hin zu Verfolgung und Mord im Globalen Süden. Es sind keine abstrakten Vorwürfe, die beiden Autoren zeichnen auf der Basis von Recherchen des kanadischen Citizen Lab eine Vielzahl von Fällen nach, von getöteten Journalisten, Oppositionellen und Menschenrechtsaktivist:innen bis hin zu den Verstrickungen von Meta (damals Facebook) in Myanmars Völkermord an den Rohingya. Und die Aktualität hat sie bereits überholt: Mittlerweile regiert auch in den USA ein Autokrat, mit dem sich die Techkonzerne eilfertig selbst gegen die eigene Bevölkerung verbrüdern.
Europas koloniale Fratze
Kritisch setzen sich Dachwitz und Hilbig auch mit Europa auseinander, dem ursprünglichen Zentrum kolonialer Macht, wo die EU aktuell mehr schlecht als recht versucht, dem monopolartigen Überwachungskapitalismus der Techkonzerne mit Regulierungen oder dem Aufbau eigener digitaler Infrastrukturen beizukommen. Bloss, wie soll das funktionieren, wenn wie im Fall des Cloudprojekts «Gaia-X» auch Microsoft, Google, Amazon, Huawei, Alibaba und sogar der Überwachungskonzern Palantir (siehe WOZ Nr. 16/21) beteiligt sind?
Überhaupt mischt die EU längst in der neokolonialen Ausbeutung und Unterdrückung Afrikas mit: Auch sie investiert im grossen Stil in digitale Infrastrukturprojekte analog zu jenen Chinas, um sich Zugang zu den Daten und Rohstoffen des Kontinents zu verschaffen. Die öffentlichen Gelder dafür sollen, so entlarven die Autoren im Zuge ihrer Recherche, aus dem Budget der Entwicklungszusammenarbeit kommen – zulasten «klassischer» Entwicklungsprojekte im Bildungs- und Gesundheitsbereich.
Bereits 2015 hat die EU fünf Milliarden Euro aus diesem Topf in einen «Emergency Trust Fund» für Afrika umgeleitet. Hinter dem wohlklingenden Namen verbirgt sich ein ganz anderes Ziel: die Bekämpfung der Ursachen von «irregulärer Migration». Die EU finanzierte seither biometrische Identifizierungssysteme in Marokko, Tunesien, dem Senegal und Côte d’Ivoire und versorgte die libysche Küstenwache mit einem Satellitenkommunikationssystem und handfestem militärischem Equipment. Hinzu kommen EU-Forschungsprojekte wie «iBorderCtrl», «Trespass» oder «Roborder» zur KI-gestützten Überwachung und Abwehr von Migrant:innen.
Aus der Perspektive des Globalen Südens zeigt Europa zunehmend ungeschminkt die altbekannte koloniale Fratze der Macht. Und so konsequent es ist, dass die beiden europäischen Autoren auch das Schlusswort einer Stimme aus dem Süden überlassen: Der vermeintliche Lichtblick wider den digitalen Kolonialismus kommt überraschend naiv daher, was ärgerlich ist. Als wärs ein Kochrezept, skizziert die guatemaltekische Techanwältin und Menschenrechtsaktivistin Renata Ávila Pinto darin in einem Zehn-Punkte-Programm, wie die Macht von Big Tech gebrochen werden kann: Graswurzelprojekte, die sich am Konzept des digitalen Gemeinguts orientieren; globaler Schuldenschnitt; ein Ende von Patenten und «geistigem Eigentum». Das wird der komplexen Analyse auf den 300 Seiten zuvor in keiner Weise gerecht.