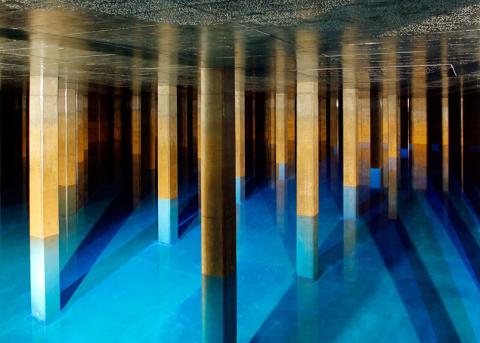Dienstleistungsabkommen Tisa: Ein Instrument zum Demokratieabbau
Die Debatte über das Dienstleistungsabkommen Tisa wird fast immer vom Ende her geführt. Doch dieses ist noch immer offen. Weit aufschlussreicher ist der Blick auf den Anfang: Er führt nicht in die Politik.
Seit drei Jahren reist Stefan Giger unermüdlich durch die Schweiz. Zuletzt sprach der Gewerkschafter vor Luzerner LokomotivführerInnen, davor besuchte er die SP-Sektion in Stein am Rhein. Fünfzig Leute waren da. «Ich war überrascht vom Andrang», sagt Giger.
Der 58-jährige Gewerkschaftssekretär des Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hat eine Mission: Er will das Zustandekommen des Dienstleistungsabkommens Tisa verhindern. «Das Tisa soll Dienstleistungen, auch jene der öffentlichen Hand, weltweit total deregulieren und privatisieren», warnt er. Doch seine Warnrufe verhallen weitgehend ungehört. Medien und Politik thematisieren das Tisa kaum, eine breite öffentliche Debatte liegt in weiter Ferne. Giger steht mit seiner Einschätzung, das Abkommen sei «eines der wichtigsten politischen Geschäfte der Gegenwart», ziemlich einsam da.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Tisa bisher ein Phantom ist. Seit über vier Jahren handelt eine Gruppe von fünfzig Staaten – mehrheitlich reiche Industrienationen aus dem Norden – in Genf neue Rahmenbedingungen im globalen Handel mit Dienstleistungen aus. Es geht um das Gesundheitswesen, die Telekommunikation, die Energieversorgung, die Bildung: um vieles also, was wir dringend zum Leben brauchen. Doch solange das geheim verhandelte Abkommen nicht fertig verhandelt ist, bleibt es mitsamt seinen Auswirkungen abstrakt – und das ist Gift für eine Debatte.
Das ungleiche Duell
Es ist nicht das einzige Handicap, mit dem Stefan Giger zu kämpfen hat: Das Tisa weist eine komplexe Struktur auf, die für NichtexpertInnen kaum nachvollziehbar ist. Die Komplexität zeigt sich exemplarisch auf der Website des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), das für die Schweiz die Tisa-Verhandlungen im Auftrag des Bundesrats führt. Dort sind zwar löblich viele Tisa-Dokumente und -Dossiers aufgeschaltet, doch sind diese weder aus dem Englischen übersetzt worden noch in verständlicher Sprache zusammengefasst und erklärt.
Christian Etter sitzt mit am Tisch, wenn in Genf hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Der 64-Jährige ist Delegierter des Bundesrats für Handelsverträge beim Seco und leitet für die Schweiz die Tisa-Verhandlungen. Seit drei Jahrzehnten arbeitet er für den Bund im Bereich der Aussenwirtschaft. Etter ist ein Verhandlungsprofi. Auch er hat eine politische Mission: das Tisa zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
So will es sein Auftraggeber. Es ist ein offizielles Jahresziel des Bundesrats, dass die Botschaft zum Tisa 2017 steht. Mit dem Abkommen möchte der Bundesrat «die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Dienstleistungsanbieter und die Rechtssicherheit für ihre internationalen Aktivitäten stärken».
Christian Etter und Stefan Giger traten in den letzten Jahren mehrfach an Podien gegeneinander an. Während ihrer Rededuelle fragt man sich unweigerlich, ob der Aussenwirtschaftsbeauftragte und der Gewerkschafter wirklich über dasselbe Abkommen referieren – so grundverschieden sind die Haltungen und Einschätzungen. Etter sieht im Tisa dank «verbesserter Marktzugänge» Wachstumschancen für den einheimischen Dienstleistungssektor. Für Giger hingegen lauern im Dienstleistungsabkommen Gefahren für unseren Service public und ein Demokratieabbau.
Es ist kein Duell auf Augenhöhe, denn Etter ist immer mindestens einen Schritt voraus. Wenn Giger die Gefahr der Privatisierung von Staatsbetrieben wie der Swisscom thematisiert, beschwichtigt Etter umgehend. Die Verhandlungsdelegation sei sich dieser Gefahr bewusst und werde sie unterbinden. Seine simple Botschaft lautet: Wir haben alles im Griff. Etter wiederholt bei jeder Gelegenheit, der Service public sei in seiner heutigen Form ungefährdet. Gigers Warnungen hingegen bleiben hypothetisch, solange das Tisa nicht fertig verhandelt ist.
Verhandlung ohne Mandat?
Die Debatte über das Tisa wird zu stark vom offenen Ende her geführt. Der Blick auf den Anfang ist aufschlussreicher. Er reicht zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als der globale Handel darniederlag. Um ihn anzukurbeln, wurde zunächst das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) abgeschlossen, aus dem später die Welthandelsorganisation (WTO) hervorging.
Der Freihandel diente vor allem dem reichen Norden. Die Länder des Südens begannen, sich immer mehr dagegen zu wehren. Der Streit kulminierte in der Doha-Runde, die 2001 begann und heute als gescheitert gilt. Die Entwicklungs- und Schwellenländer verlangten unter anderem, dass die reichen Länder aufhören, verbilligte Lebensmittel zu exportieren, die die Landwirtschaft im Süden ruinieren. Der Norden ging zu zögerlich darauf ein.
Um ihre Interessen trotzdem durchzudrücken, setzen die reichen Länder auf Handelsabkommen, die sie mit willigen Partnern ausserhalb der WTO schliessen. Deren Anzahl ist inzwischen geradezu explodiert. Das Tisa ist eines dieser Abkommen.
Brisant ist, dass die Schweiz die Verhandlungen ohne eigentliches Mandat führt: Als Basis dient immer noch das Doha-Mandat, das der Bundesrat vor fünfzehn Jahren verabschiedet hat – obwohl das Tisa nicht zur WTO gehört. Das Mandat ist nicht öffentlich.
«Industrieländer machen die Regeln»
Für Isolda Agazzi, Handelsexpertin von Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft der grossen Schweizer Hilfswerke, ist das Tisa «ein politisches Projekt der Dienstleistungskonzerne». Sie zitiert ein öffentliches Dokument der Global Services Coalition, des multinationalen Lobbydachverbands im Dienstleistungsbereich. Dort heisst es: «Das Tisa ist konzeptionell darauf ausgelegt, den Frustrationen der Wirtschaft über den Stillstand der Doha-Runde und der Verhandlungen über Dienstleistungen etwas entgegenzusetzen.»
Aus diesem Grund sitzen die «lästigen» Schwellen- und Entwicklungsländer in Genf – mit ganz wenigen Ausnahmen – nicht am Verhandlungstisch. Sondern nur die «Really Good Friends of Services». So nennen sich die fünfzig verhandelnden Staaten selbst. «Die Quintessenz des Tisa besteht darin, die wichtigsten Entwicklungsländer dazu zu bewegen, einem Abkommen beizutreten, dessen Bedingungen die Really-Good-Friends-Gruppe diktiert hat», sagt Agazzi.
Es sei ein bekanntes und «bewährtes» Muster: «Die Regeln machen die Industrieländer unter sich aus. Aber die Länder des Südens sollen sich später gerne anschliessen. Das ist der Plan», sagt Agazzi. «Dabei bräuchten diese Länder gerade keine Deregulierung der Märkte, sondern vielmehr stärkere Regeln und Schutzmassnahmen, um die gesellschaftlichen Interessen im sozialen Bereich oder jenem der Umwelt wahren zu können.»
Wer darf mitreden?
Die beiden kanadischen Politikwissenschaftler Scott Sinclair und Hadrian Mertins-Kirkwood stützen die Darstellung von Isolda Agazzi in einer Studie. Sie schreiben, dass das Tisa «eine Kopfgeburt der US Coalition of Services Industries (CSI) zu sein scheint» – einer Lobbygruppe der US-Dienstleistungskonzerne, der beispielsweise Google, Walmart oder Citigroup angehören. Bereits 2009, drei Jahre vor Beginn der offiziellen Verhandlungen, schlug die CSI plurilaterale Verhandlungen über den Handel mit Dienstleistungen vor.
Im März 2013 unterbreitete der Lobbydachverband dem zuständigen US-Handelsbeauftragten eine ganze Reihe von Vorschlägen und gab dabei die Richtung vor: Das auszuhandelnde Dienstleistungsabkommen habe «Regulierungen innerhalb der Grenzen zu ändern oder ganz abzuschaffen». Finanzdienstleister, Internetkonzerne und andere Firmen mit globaler Geschäftstätigkeit sollten in einem Umfeld mit «marktorientierten und nicht vom Staat vorgegebenen Bedingungen» handeln können.
Wie weit die versuchte Einflussnahme der Konzerne ging, verdeutlichen deren öffentlich einsehbare Vorschläge an den US-Handelsbeauftragten. Etwa jener des Logistikriesen FedEx, der im Januar 2013 «gleiche Wettbewerbsbedingungen für private und öffentliche Zustelldienste» forderte sowie die Beseitigung «regulatorischer Vorteile, die den nationalen Postdiensten traditionsgemäss gewährt werden».
Ellen Gould, Forscherin am kanadischen Centre for Policy Alternatives, schreibt dazu: «Die staatliche Post hat aber die Aufgabe, auch Teile des Marktes wie zum Beispiel weit abgelegene Gegenden zu bedienen, an denen gewinnorientierte Anbieter wie FedEx oder andere transnational agierende Zusteller aus Mangel an Gewinnaussichten nicht interessiert sind.» Die Beseitigung von Regulierungsmassnahmen, die den staatlichen Postdiensten Vorteile verschaffen, beeinträchtige deren Fähigkeit, ihre Gemeinwohlverpflichtungen zu erfüllen, so Gould.
Es war nicht die Politik, die den Impuls zum Tisa setzte. Entsprechend ist auch die Zielsetzung des Abkommens: Für Dienstleistungsanbieter soll der Marktzugang möglichst hürdenfrei sein. Anders ausgedrückt: Es geht um die Einschränkung der staatlichen Handlungsspielräume. Das Tisa bedeutet einen Abbau von Demokratie.
Von Anfang an waren die Wirtschaftsverbände in die Tisa-Verhandlungen eingebunden – und begleiten sie bis heute intensiv weiter. Im Gegensatz zu Gewerkschaften, KonsumentInnenorganisationen oder Umweltverbänden.
Das verdeutlicht etwa eine Auswertung der Transparenzinitiative Lobby Control. Sie zeigt, mit wem die Mitglieder der EU-Handelsdirektion bisher Gespräche über das Tisa führten: In 89 Prozent der Fälle waren es UnternehmensvertreterInnen. Toplobbyakteur war Digitaleurope, der europäische Branchenverband, der die Interessen von Amazon, Apple oder Siemens vertritt.
Beim Seco sieht das nicht anders aus, wie eine auf das Öffentlichkeitsgesetz gestützte WOZ-Anfrage aufzeigt: VertreterInnen der Schweizer Verhandlungsdelegation nahmen seit Sommer 2013 an insgesamt vierzehn «informellen Treffen» teil. Dreizehn davon entfielen auf Lobbygruppen oder Wirtschaftskanzleien, allein viermal fand ein Austausch mit der Global Services Coalition statt. Hinzu kam ein Treffen mit einer Genfer NGO, die Nachhaltigkeit und Freihandel zusammenbringen will.
Kommt das Tisa 2017?
Selbst die grössten Tisa-GegnerInnen wie Stefan Giger oder Isolda Agazzi erkennen an, dass die Schweiz – nach allem, was bisher öffentlich bekannt ist – gut verhandelt. Die erfahrene Delegation weiss, was sie tut, und sie schützt den Service public so gut wie möglich. «Die Schweiz bietet in ihrer nationalen Verpflichtungsliste keine Marktzugangsverpflichtungen beispielsweise für Tätigkeiten des Service public wie das öffentliche Bildungswesen, das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, den öffentlichen Verkehr, audiovisuelle Dienstleistungen – inklusive SRF – oder bei der Post und der Energieversorgung», sagt Christian Etter vom Seco.
Doch entscheidend ist, was im fertigen Abkommen stehen wird. «Bei solchen Verhandlungen müssen am Ende alle Teilnehmer irgendwo Abstriche machen», sagt Stefan Giger und nennt ein konkretes Beispiel: «Im Oktober hat die Schweiz ihre dritte Tisa-Offerte publiziert. Im Unterschied zu den ersten beiden Offerten sollen nun auch für die Kantone und die Gemeinden die gleichen Regeln gelten wie beim Bund. Auch für sie sollen nun in gewissen Sektoren die Stillhalte- und die Sperrklinkenklausel zur Anwendung kommen» (vgl. «Neue Mechanismen» im Anschluss an diesen Text).
Schliesslich darf das Verhandlungsgeschick der Seco-Delegation nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schweiz aktiv ein Abkommen vorantreibt, das für die Länder des Südens den Verlust von politischer Souveränität bedeutet.
Das Tisa hätte bis Ende 2016 fertig verhandelt sein sollen, doch die Verhandlungen gerieten zuletzt ins Stocken. Anfang Dezember ist ein geplantes Ministertreffen nicht zustande gekommen. Der Grund: Die USA und die EU sind sich uneinig über den Umgang mit persönlichen Daten. Während die USA auf einen möglichst uneingeschränkten Datenfluss pochen, hat die EU erst kürzlich den Datenschutz gestärkt und will daran festhalten.
«Trump liebt Deregulierung»
Ein anderer Grund ist die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Bisher hat er sich noch nicht konkret zum Tisa geäussert. Die Medien skizzieren Trump gerne als Freihandelsgegner. Doch das sei ein Missverständnis, sagt Deborah James vom Center for Economic and Policy Research: «Er sagte im Wahlkampf vielmehr, er denke, dass die US-Verhandler einen schlechten Job gemacht und schlechte Deals ausgehandelt hätten. Nun werde er verhandeln und gute Deals erzielen.»
Beim Tisa gehe es darum, Deregulierung und Privatisierung weiter zu fördern: «Trump liebt beides», sagt James. Ausserdem gehe es um Dienstleistungen und nicht um Produkte. «Seine Wählerbasis in der Arbeiterklasse ist vom Tisa weniger betroffen als von Handelsabkommen wie dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP, das Arbeitsplatztransfers in ein Billiglohnland wie Vietnam mit sich bringen würde.»
Beim Seco ist man vorsichtig mit Prognosen: «Ein Verhandlungsende ist zurzeit nicht absehbar», sagt Christian Etter. Gewerkschaftssekretär Stefan Giger hält jedoch das erklärte Ziel des Bundesrats, dem Parlament noch in diesem Jahr die Tisa-Botschaft zu unterbreiten, durchaus für realistisch: «Falls das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU wirklich vollends scheitert, ist es sogar denkbar, dass beim Tisa eine zusätzliche Dynamik entsteht, damit wenigstens im Dienstleistungsbereich die Deregulierungsziele umgesetzt werden.»
Wie das Parlament über eine mögliche Tisa-Botschaft entscheidet, ist völlig offen. Bisher haben sich nur SP und Grüne wirklich eingehend mit dem Dienstleistungsabkommen befasst und eine klare – ablehnende – Haltung entwickelt (vgl. «Kritisch – oder noch gar nicht informiert?» im Anschluss an diesen Text). FDP, CVP, BDP und GLP befürworten den Freihandel grundsätzlich; wo die SVP steht, ist noch unklar.
Für die politische Mission von Stefan Giger könnte sich die Tisa-Botschaft nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance herausstellen. Das Dienstleistungsabkommen wäre kein abstraktes Phantom mehr. Zudem könnten die Politik und die Medien das Tisa nicht mehr ignorieren. Vielleicht kann Giger dann mit ähnlich prägnanten Bildern und Narrativen die öffentliche Debatte prägen, wie das den TTIP-GegnerInnen so erfolgreich gelungen ist.
Empfehlenswerte Bücher zum Thema:
Petra Pinzler: «Der Unfreihandel. Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien. TTIP – Tisa – Ceta». Rowohlt Taschenbuch. Reinbek 2015. 288 Seiten. 18 Franken.
Harald Klimenta, Marita Strasser, Peter Fuchs u. a.: «38 Argumente gegen TTIP, Ceta, Tisa & Co. Für einen zukunftsfähigen Welthandel». VSA Verlag. Hamburg 2015. 96 Seiten. 12 Franken.
Neue Mechanismen
Das Tisa stützt sich im Wesentlichen auf das Gats, das Dienstleistungsabkommen, das 1995 im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) in Kraft trat. Im Unterschied zum Gats wird Tisa jedoch ausserhalb der WTO verhandelt, und es enthält mit der Stillhalte- sowie der Sperrklinkenklausel auch neue Mechanismen.
Beide zielen auf eine Deregulierung ab. Die Stillhalteklausel friert die gültigen Liberalisierungs- und Marktzugangsregeln zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Tisa ein. Kommt die Klausel in einem Dienstleistungssektor zur Anwendung, dürfen die entsprechenden Regeln nicht mehr zurückgenommen werden. Die Sperrklinkenklausel hingegen bezieht sich auf künftige Liberalisierungsschritte. Wird zum Beispiel in einem Land in Zukunft die Wasserversorgung privatisiert, darf sie nicht in die öffentliche Hand zurückgeführt werden, selbst wenn die Liberalisierung nicht die gewünschten Resultate bringt.
Tanzen gegen Tisa
Im Berner Nachtleben ist sie längst legendär: die Tour de Lorraine, aus dem Widerstand gegen das Wef entstanden. Dieses Jahr geht es zurück zu den Wurzeln: zur Globalisierungskritik. An Workshops, Vorträgen und Stadtrundgängen gibt es viel über Freihandelsabkommen zu lernen, dazu steht «Tanzen gegen Tisa» auf dem Programm: am 20. Januar 2017 ein Radioballett auf dem Bahnhofplatz, am 21. Januar 2017 laden 22 Bands und 11 DJs in 18 Lokalen zum Tanz ein. Die Einnahmen kommen linken Projekten zugute. So gehen Spass und politische Bildung zusammen.
Die Parteien und das Tisa: Kritisch – oder noch gar nicht informiert?
Eine Umfrage bei den grossen Bundeshausparteien zeigt, dass sich Grüne und SP bereits intensiv mit dem Dienstleistungsabkommen beschäftigt und entsprechend eine klare Haltung entwickelt haben: Beide Parteien lehnen das Tisa grundlegend ab, sie haben an ihrer jeweiligen Delegiertenversammlung bereits entsprechende Resolutionen verabschiedet. Ausserdem haben linke PolitikerInnen wie Regula Rytz (Grüne) oder Jean Christophe Schwaab (SP) im Parlament schon diverse Vorstösse eingebracht.*
Bei den Mitte- und Rechtsparteien BDP, CVP, FDP, GLP und SVP steht eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Dienstleistungsabkommen noch bevor. Sie würden erst mal den Abschluss der Verhandlungen und die Tisa-Botschaft des Bundesrats abwarten, heisst es bei ihnen. Grundsätzlich ist die Haltung dem Tisa gegenüber bei diesen Parteien aber positiv. Mit Ausnahme der SVP: Sie hat noch keine grundsätzliche Haltung entwickelt. Immerhin liess die Partei verlauten, sich «für die Möglichkeit einer Unterstellung unter das fakultative Referendum einzusetzen».
Auf kommunaler und teils auch auf kantonaler Ebene war das Tisa schon mehrfach ein Politikum. Etwa in Bern: Dort forderten vor zwei Jahren die Stadtparlamentarierinnen Katharina Gallizzi und Regula Bühlmann (Grünes Bündnis) in einer Motion, dass Bern zur «Tisa-freien Zone» erklärt wird. «Das Tisa ist demokratiepolitisch sehr heikel», sagt Gallizzi. «Wenn das Abkommen in Kraft tritt, wären auch kommunale Strukturen in der Stadt Bern betroffen, ohne dass die Bevölkerung hier sich dazu äussern dürfte.» Im November 2016 stimmte der Berner Stadtrat der Motion zu.
Neben Bern haben sich auch Zürich, Genf, Lausanne und Baden zu Tisa-freien Zonen erklärt. Bald könnte Basel folgen. Katharina Gallizzi ist bewusst, dass es sich dabei in erster Linie um «Symbolpolitik» handelt, diese sende aber ein «starkes Signal» aus. «Zudem hat auf städtischer Ebene nun schon eine politische Debatte über das Tisa stattgefunden – die Politiker und Institutionen sind sensibilisiert und wissen, was auf dem Spiel steht.»
* Einen guten Überblick über die parlamentarischen Interventionen liefert die Website des Seco: www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche….