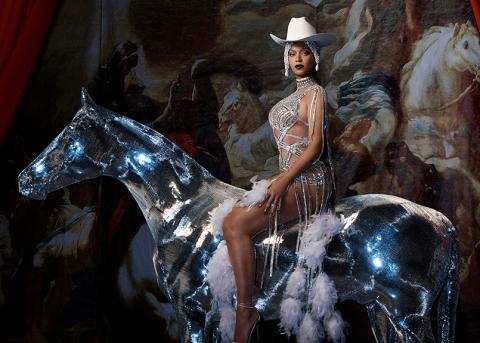Elektro: Das California Girl in den Anden
Ein Geflecht aus tausend Einflüssen: Die 32-jährige Elysia Crampton verwebt in ihren Tracks die queere Subkultur mit den rituellen Klängen der südamerikanischen Aymara.

Vielleicht verhält es sich mit kulturellen Identitäten ja so wie mit zeitgenössischer elektronischer Musik. Sie schichtet und schichtet sich, es klingen Spuren aus dieser Epoche und Überreste aus jener Kulturregion durch – und am Ende bleibt eine riesige Gemengelage, die es zu entschlüsseln gilt.
Im Fall von Elysia Crampton bietet sich eine solche Analogie an. Die in Kalifornien geborene und heute wieder dort lebende Produzentin ist musikalisch wie biografisch von verschiedenen Kulturen geprägt: als indigene Künstlerin – sie stammt aus einer Familie der Aymara, einer indigenen südamerikanischen Ethnie – von ländlichen Bräuchen, Ritualen und Musiken; als Transfrau von der queeren Subkultur; und als «California Girl», wie sie sich manchmal selbst nennt, von Popmusik von Britney Spears, Destiny’s Child oder Marilyn Manson.
Afrikanisch, spanisch, inkaisch
Aus allen diesen Einflüssen entsteht bei Elysia Crampton spektakuläre Musik. Das fünfte Album der 32-Jährigen versammelt sechs hochkomplexe, rhythmisch verstolperte Tracks, in denen Folk genauso Platz hat wie Industrial und jüngere lateinamerikanische Stile wie Digital Cumbia mit elektronischen Subgenres wie Footwork zusammenkommen.
Die Heimat ihrer Eltern und Grosseltern in Bolivien besuchte Elysia Crampton erstmals mit elf Jahren, seither ist sie häufig dort. Vor einem Konzert im Berliner Berghain erzählt sie, wie ihr vor allem ihr Grossvater, den sie bis zu dessen Tod immer wieder in den Anden besuchte, die Musik der Aymara nahegebracht hat. Er zeigte ihr Instrumente wie die Charango, verschiedene Blasinstrumente sowie Trommeln wie die Bombo und die Wancara. Auch Aymara-Musik gehe auf viele unterschiedliche Wurzeln zurück, sagt Crampton, schliesslich sei die Menschengruppe auch nicht homogen: «Es gibt einen afrikanischen Einfluss aus der Zeit der Kolonisation, dann ist da ein spanischer Einfluss mit Instrumenten wie eben der Charango oder der Harfe, und natürlich gibt es einen alten Einfluss durch die Inka.»
Zu Hause gab es nur Klassik
Die Geschichte der Aymara reicht weit zurück – wie lange genau, darüber streiten HistorikerInnen. Im 13. und 14. Jahrhundert hatten Aymara in Südamerika grössere Gebiete inne, dann gerieten sie unter die Herrschaft der Inka. Später, zur Zeit der spanischen Kolonisation, wurden sie oft verdrängt und unterdrückt. Heute leben die rund zwei Millionen Aymara in Bolivien, Chile und Peru. Diese Geschichte wirkt bis in die Gegenwart nach, bis zu Elysia Crampton: Ihre Vorfahren wurden einst von einer adventistischen Glaubensgemeinschaft evangelisiert, sie selber wuchs in einer christlich-konservativen Familie auf.
Das war auch der Grund dafür, dass Rock- und Popmusik in ihrem Elternhaus tabu war, zu Hause durfte sie nur Klassik hören. «Ich konnte mich aber auch dem Minimalismus widmen, der immer noch einen bedeutenden Einfluss auf mich hat. Die klassischen Minimalisten wie Peter Garland interessierten mich, und ich war ein grosser Fan von John Adams, der Leiter der Philharmonie in Los Angeles wurde, als ich zur Highschool ging.» In diesen Stilen sieht sie auch eine direkte Linie zur Musik der Indigenen in den USA: «Von denen haben sich die Minimal-Musiker viel abgeschaut, zum Beispiel Formen der Wiederholung und der Übergänge.»
Als Kind lernte sie Keyboard, seit ihren frühen Zwanzigern macht sie elektronische Musik – zunächst unter dem Alias E + E, dann unter ihrem eigenen Namen. Dabei studierte sie zunächst bildende Kunst, später Soziologie, ohne das Studium abzuschliessen. Als Musikerin wurde sie schnell zum Geheimtipp der internationalen Clubszene, vor allem in der queeren Subkultur wird sie verehrt. Ihr neues Album hat sie Carlos Espinoza gewidmet, der als «Ofelia» eine bedeutende Travestiekünstlerin im Bolivien der 1960er und 1970er Jahre war. Espinoza deutete die Figur der China Supay, bei den Aymara einst die weibliche Verkörperung des Teufels, positiv für die frühe queere Kultur um. Teile der Aymara-Kultur, so Crampton, sähen Queers als Bereicherung, seien ihnen gegenüber sehr aufgeschlossen. In ihrem Elternhaus dagegen hatte sie Probleme, weil sie als Mensch zwischen den Geschlechtern nicht ins christliche Glaubenskonzept passte.
Pumpen und sirren
Elysia Cramptons Biografie ist voller Kulturgeschichte – diese verarbeitet sie in ihrer Musik. Ein paar Stunden nach dem Interview steht sie in buntem Kostüm mit einem Umhängekeyboard auf der Bühne. Bässe pumpen, Synthies sirren, und zwischendurch hört man die gesampelten Trommeln der Indigenen. Auch ihr neues Album, das nicht einmal zwanzig Minuten dauert und auf dem Gesang nur gesampelt vorkommt, klingt voll und spannend wie ihre Geschichte. Es wirkt, als liefen darauf ständig mehrere Tracks in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und mit unterschiedlichen Rhythmen zugleich. Dabei entsteht aus dieser Melange eben kein Chaos, kein völlig undurchdringlicher Noise – sondern ein dichtes, ineinandergreifendes musikalisches Geflecht.
Elysia Crampton: Elysia Crampton. Break World Records. 2018