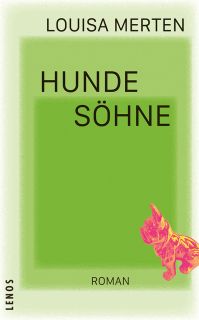Literatur: Das Zuhause als Geschwür
Louisa Mertens Debüt «Hundesöhne» ist sprachlich fesselnd, verheddert sich zum Teil aber auch in den eigenen Konstruktionen von Identität und Herkunft.
Unten in der Talsenke, nur sichtbar, «wenn man in den Abgrund schaut», liegt das «Lösch». Das Tierheim ist ein Sammelbecken für Heimatlose. Für auf der Strasse gefundene Katzen und von Narkosemittel süchtige Pekinesen. Und für Ginny. Wie die misstrauischen Tiere mit schwierigen Vergangenheiten versucht die Tierpflegerin, ihr früheres Leben abzustreifen, indem sie im Tal neu beginnt. Aber ihre Vergangenheit bleibt an ihr kleben wie der getrocknete Kot an den Teppichen im Lösch.
In ihrem Debüt «Hundesöhne» folgt die Schweizer Autorin Louisa Merten der Ich-Erzählerin bei ihrer Suche nach Identität, Zugehörigkeit und Heimat. In Rückblenden schildert Ginny ihre leicht melodramatische Flucht sechs Jahre zuvor. Sie hatte ihre Familie auf dem Berg für das Tierheim im Tal verlassen, weil sie auf Gemeinschaft und Nähe hoffte. Das Verhältnis zu ihrem Bruder vergleicht sie mit der karierten Decke im Auto des «Mannes, den ich Papa nannte»: «Wir passten zueinander wie die roten und grünen Linien auf der Decke, die man gezwungen hatte, nebeneinander zu verlaufen.»
Das Inserat für eine Lehrstelle bei Sebrov im Tierheim sieht Ginny als willkommenen Wink, um sich auf die Spuren ihres abwesenden leiblichen Vaters zu begeben. Doch statt ihren Wurzeln nachzugehen, findet sie im Lösch bei den Hunden und Katzen bedingungslose Liebe und in Sebrov eine Wahlverwandtschaft. Mit dem verwitweten Betreiber des schmuddeligen Heims teilt sie ihre Verlorenheit.
Für die derbe Realität kotverschmierter Katzenschwänze und sabberverklebter Futternäpfe, um die sich Ginny kümmern muss, findet Merten eine plastische Sprache. Ein fast körperlich spürbarer Ekel zieht sich durch den Roman. Der Arbeit und den Abläufen eines Tierheims sei sie, das sagte Merten 2021 gegenüber dem «Bund», bei einem Kurzpraktikum näher gekommen. Dennoch sei das Lösch rein fiktiv. Ihre literarischen Qualitäten hat die Endzwanzigerin am Bieler Literaturinstitut und bei einem Master an der Berner Hochschule der Künste verfeinert.
Wie ein wildes Tier
Mertens Protagonistin Ginny bleibt ambivalent. Wenn sie sich schmollend in den Zeilen «Nur mein Schatten geht an meiner Seite» von Green Day wiedererkennt, rutscht sie etwas in jugendliches Pathos ab. Man ist sich nicht immer sicher, ob ihr alles zu glauben ist, und ihr prinzipielles Misstrauen gegenüber allen ist nicht immer (auf Anhieb) nachvollziehbar. Warum glaubt sie, in der neuen Praktikantin Aka, die auf einmal im Tierheim steht, eine Bedrohung ihrer Wahlfamilie zu erkennen?
Aka setzt bei Ginny eine Entwicklung in Gang: So verfolgt sie überstürzt einen Mann, den sie für ihren Vater hält, und lebt darauf wie ein wildes Tier im Wald. Die zu Beginn des Textes noch klar von ihrem unmittelbaren Erleben abgegrenzten Rückblenden drängen sich nun stärker in die Gegenwart. Im Erleben, Erinnern und Träumen vermischen sich die Zeitebenen. Immer deutlicher zeigt sich, dass Ginny ihre Vergangenheit nicht abstreifen kann. Sie denkt: «Was dein Zuhause war, wächst dir wie ein Tumor ans Herz.» Es ist wie ein Geschwür, von dem sie sich weder trennen kann noch will. Wenn die Liebe ein «Messer ist, das mit jedem Streicheln geschärft wird», erscheint Ginnys Misstrauen gegenüber Menschen viel eher als ein Misstrauen gegenüber der Liebe selbst: als Ausdruck einer Angst, geliebte Menschen oder Tiere zu verlieren.
Alter Ego oder Plot Device?
Mertens Sprache ist ungeheuer präzis und bewegt sich, von Ausnahmen abgesehen, jenseits von Klischees und abgenutzten Metaphern: wenn etwa «die Regenfinger» Ginnys Rücken hinunterkriechen oder ein Lachen klingt, «wie wenn ein zugefrorener See in der Frühlingssonne auseinanderbricht». Besonders gelungen ist Merten das Spiel mit Ambivalenzen und Andeutungen zwischen dem, was in der Vergangenheit tatsächlich vorgefallen ist, und dem, was hätte vorgefallen sein können. Immer wieder tauchen unterschwellige Hinweise auf gewaltvolle Beziehungen auf. Dass vieles in «Hundesöhne» in der Schwebe bleibt, erlaubt verschiedene Lesarten.
Etwas nebulös allerdings ist die Aka-Figur, wohl das schwächste Element des Romans. Sie bleib vage, taucht ohne plausible Erklärung auf und verschwindet genauso abrupt wieder. Als wäre sie ein Plot Device – nichts als ein Element, das Ginnys Entwicklung vorantreibt. Möglich, dass Aka als Ginnys Alter Ego mehr einen Bewusstseinszustand der Protagonistin als eine eigenständige Figur darstellen soll; wohl kaum zufällig entspricht ihr Name der Abkürzung «also known as» (auch bekannt als). Diese Lesart funktioniert jedoch höchstens mit viel Interpretationswillen, denn dafür sind die beiden Charaktere eigentlich zu eigenständig.
Dennoch ist Merten ein tiefsinniger Roman gelungen, der sich mit dem kaleidoskopischen Charakter von Erinnerungen auseinandersetzt und dabei durchaus eine gewisse Denkleistung von den Lesenden einfordert, manchmal erneutes Lesen einzelner Passagen. Das wiederum ist programmatisch für den Text und die Protagonistin: Was einen ausmacht, ist häufig erst im Rückblick auszumachen.