Unversöhnt Die Psychoanalyse diente immer auch dazu, die Gesellschaft zu analysieren, insbesondere was autoritäre Dynamiken anbelangt. Hilft sie uns heute noch, die Welt zu verstehen?

Vielleicht da beginnen, wo man denkt, darin würde alles münden: bei all den Krisen, die uns wie Gewitter entgegenpeitschen, ein Gefühl des Überwältigtseins, der Ohnmacht hinterlassen, den Untergang nahelegen, ja, wie lässt sich eigentlich noch darüber nachdenken, was gerade passiert, dauernd im roten Bereich drehend? Wir würden in einer undenkbaren Zeit leben, sagte der Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit im Frühling in einem Interview. Irgendwas schlummert bedrohlich.
Wie sich da nicht einfach auf diese eigene Hilflosigkeit zurückziehen, der Ohnmacht erliegen, gar den Zusammenbruch herbeifantasieren oder sich ganz abwenden, endlich mal Ruhe? Irgendwas schlummert bedrohlich, auch auf dem eigenen Seelenboden.
Und vieles ist ja längst an die Oberfläche geraten: Krisenzeiten sind Zeiten, in denen Demagog:innen, autoritäre Kräfte, Bewegungen, Parteien und Haltungen, Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus, die Donald Trumps, Alice Weidels oder Andrew Tates dieser Welt an Boden gewinnen. Der Kampf gegen den Autoritarismus, der Griff nach der Notbremse, scheint kompliziert, schwierig, aussichtslos gegenüber der Mühelosigkeit, mit der sie sich Anhänger:innen verschaffen – nur, warum eigentlich? «Malaise», nannte der Soziologe und Literaturwissenschaftler Leo Löwenthal 1949 den Krisenzustand, in dem «der einzelne in einer Periode tiefgehender Veränderungen strukturellen Belastungen» ausgesetzt sei. In den Krisen, sagte Löwenthal, spiegle sich das individuelle Leiden.
Wir sollten gar nicht so tun, als könnten wir das, was um uns herum abläuft, verstehen und erklären wie den Lauf von Billardkugeln, sagte Theweleit, aber vielleicht liefert die Psychoanalyse Antworten oder zumindest ein Werkzeug, um darüber nachzudenken, was sich in der Gesellschaft gerade vollzieht: Schliesslich waren es Psychoanalytiker:innen und daran orientierte Sozialwissenschaftler:innen aus der Kritischen Theorie, Löwenthal, Erich Fromm oder Theodor W. Adorno, die in den zwanziger und dreissiger Jahren angesichts der gescheiterten sozialistischen Revolution in Deutschland und der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, verstehen wollten, wieso die Arbeiter:innen nicht gegen die Verhältnisse aufbegehrten, die sie knechteten, wie sich die Ideologie der Herrschenden auch im Gefühlsleben der Beherrschten wiederfand. Warum die Deutschen in freien Wahlen für die NSDAP stimmten und wie sich Menschen an autoritären Institutionen und Bewegungen von inneren Konflikten «schiefheilten» – die ihre Ängste banden und Aggressionen kanalisierten, die ihnen durch narzisstische Identifizierung eine Teilhabe an der Macht versprachen.
Während der Naziherrschaft ins Exil vertrieben, analysierten sie, warum sich Menschen freiwillig antidemokratischen Agitator:innen unterwerfen, wie Vorurteile zustandekommen und Ressentiment entsteht, mit welcher Kontinuität sich autoritäre Bedürfnisse durch die Gesellschaft ziehen. Ohne die Ebene des Unbewussten, die verborgenen Bedürfnisse und Wünsche in die Untersuchungen miteinzubeziehen, sei das nicht zu erklären.
Heute ist vieles anders, aber die Fragen sind die gleichen: Warum wählen Leute Donald Trump, die AfD, warum befürworten und vertreten sie autoritäre, menschenfeindliche Politik, was sagt uns das über den Menschen in der Malaise?
Wir befänden uns am vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung, die in den siebziger Jahren begonnen habe und unter dem Begriff «Neoliberalismus» zusammenzufassen sei, sagt Oliver Decker, Professor für Sozialpsychologie, Autor der zweijährlich erscheinenden Autoritarismusstudie der Universität Leipzig. Eine Zeit der Flexibilisierung der Arbeit, eine Zeit der Entwertung und Entgrenzung, der Freisetzung aus Normbezügen, eine Zeit, die manche mit einer Brutalität erfasst habe, die «einen Wutraum» geschaffen, einen Teppich für Ressentiments gelegt habe. Eine Zeit, in der sich der Einzelne zunehmend als ersetzbar, austauschbar, prekarisiert empfindet – zur Disposition gestellt.
«Es ist sehr viel leichter, sich darin wütend zu erleben als ohnmächtig», sagt Decker. Deshalb die Wut, die sich gegen scheinbar «andere» richtet, mal Migrant:innen, mal Frauen, mal Sozialhilfeempfänger:innen, gegen die, die ohne Schutz sind. Daher die «Destruktionspotenziale», wie Decker sagt, die in den letzten Jahrzehnten freigesetzt worden sind. Diese finden wenig überraschend in der Politik Repräsentation; in rechtsextremen, neonazistischen Mobilisierungen, aber auch, abgesehen von der klassischen autoritären Rechten, abgesehen von rechten Wähler:innen, in der Sehnsucht nach Konvention, klaren Regeln, nach dem Sanktionieren von Verstössen, in der Sehnsucht nach klaren Kategorien von Gut und Böse, Stark und Schwach, Mann und Frau, Aussen und Innen, Wir und Die. Autoritäre Bedürfnisse würden die Gesellschaft durchziehen, sagt Decker, «und ich glaube, das liegt so offen zutage wie lange nicht». Das sei der Moment, in dem wir uns gerade befänden.
Wie diesen autoritären Bedürfnissen zu Leibe rücken, wie in den Blick nehmen, wie diese entstehen, auch die eigenen? Das ist das, wobei uns die Psychoanalyse helfen kann: das Unbewusste bewusst zu machen; den Taucheranzug anzuziehen und in die Tiefen zu steigen. Dort, auf dem Seelenboden, schlummert das Ressentiment, das Gefühl des Kontrollverlusts, der Kränkung und Erniedrigung, der Wahn, alleiniges Opfer zu sein, obwohl es viele sind in dieser ungerechten Ordnung. Wer sein eigenes Leben nicht leben könne, hasse das Leben der anderen, schrieb die Psychoanalytikerin Cynthia Fleury vor wenigen Jahren in ihrem Buch «Hier liegt Bitterkeit begraben». Aber was heisst das überhaupt, sein eigenes Leben leben?
Die Kritische Theorie sprach noch vom autoritären Charakter, der sich in lustvoller Unterwerfung, Gehorsamkeit oder Konventionalismus ausdrückt, sich destruktiv und zynisch imaginäre Feinde herbeifantasiert. Ein geschwächtes Ich, das dem Es und dem Über-Ich ungezügelt freien Lauf lässt, das aber – so beschreiben es etwa die Soziolog:innen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey – nicht als individuelle Disposition zu sehen ist, sondern als Modus einer Gesellschaft, die gleichermassen auf Enthemmung und Entsagung, Freiheit und Abhängigkeit aufbaut: Zwar herrscht materieller Wohlstand, aber die Emanzipationsräume sind beschnitten.
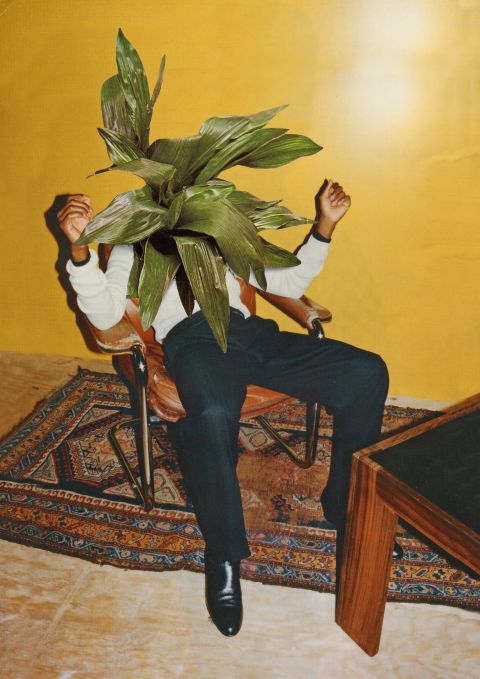
Cynthia Fleury sagt, vom Gelingen des Kampfs gegen das Ressentiment hänge das Schicksal von Menschen und Gesellschaften ab. Die Psychoanalytikerin spricht von einer «Pflicht zur Distanzierung», vom Schmerz des eigenen Unglücks. Dieses gelte es zwar ernst zu nehmen, es aber nicht vor das kollektive zu stellen, sich nicht vom Leid der Welt abzuwenden. Das ist Arbeit, die immer wieder wiederholt werden muss, während sich das Ressentiment selbst erhält: Strukturell im Menschen angelegt, ersetzt es die unerträgliche Realität – unerträglich, weil die Diskrepanz zwischen gleichen politischen Rechten und konkreten Ungleichheiten zu gross ist.
Wir wissen es alle, wir sehen es alle; irgendwas läuft nicht gut, zu gross die Ungerechtigkeiten, denen wir begegnen, zu wenig hat sich das Freiheitsversprechen der modernen Gesellschaft für alle erfüllt, liessen sich die Gleichheits- und Partizipationsansprüche umsetzen. Ohnmächtig oder willentlich hätten dazu viele die Veränderungen der letzten Jahrzehnte mitgetragen, sagt Oliver Decker, sich mit der Autorität der Ökonomie identifiziert, dem falschen Versprechen, jede:r könne sich verwirklichen. Wer unten ist, ist selbst schuld. Jemand schrieb mal auf Twitter: «Homeless? Buy a house, live in it!»
Das Ich ist konfliktreich, widersprüchlich im eigenen Handeln, Erleben und Wollen, «unversöhnt» nennt das die Psychoanalyse, genauso sei die Gesellschaft unversöhnt, der das Ich entspringe, sagt Decker. Dieses Unversöhnte habe die Psychoanalyse nie verleugnet, auch nicht legitimiert, sondern «in den Reflexionsraum geholt». Die Reflexion des unversöhnten Zustands, «der die Monster hervorbringt, die wir Autoritarismus und Faschismus nennen», die Widersprüchlichkeit menschlichen Handelns, auch der Wille zu und die Lust an der Gewalt, an der Ausgrenzung, die Freiwilligkeit, sich Autoritäten zu unterwerfen, ein Oben und Unten zu akzeptieren: «Die Unversöhntheit anzuerkennen und gleichzeitig eine Veränderung dieses Zustands anzustreben», sagt Decker. Das ist das Ziel, dort liegt die Erkenntnis.
Die Eule der Minerva beginne ihren Flug erst mit der Dämmerung, zitiert Decker den Philosopen G. W. F. F. FfffffHegel. Nur fühlt es sich manchmal an, als würde man schon ewig darauf warten, dass sie endlich abhebt, wos doch schon fast dunkel ist.
Vielleicht trotz des Gefühls der Aussichtslosigkeit, oder gerade deswegen, nicht im Krisenmodus verharren: «Der entscheidende Punkt, und da ist die Krise nicht weit entfernt von der apokalyptischen Fantasie, ist der Moment des Umschlags, der mit der Krise herbeigesehnt wird, die Idee, nach der Krise zeige sich das Gute, das Erlösende, das Bessere», sagt Decker. «Krisenfantasien sind eigentlich Sehnsüchte nach einer grundlegenden Veränderung einer Situation, die unerträglich ist.» Das Offenbarungsversprechen der Apokalypse klingt verführerisch, und es liegt nicht unweit vom Versprechen autoritärer Kräfte, dass sich etwas reinigen müsse, Stärke, Ordnung, ein Wir wiederherzustellen seien, Kontrolle und Handlungsfähigkeit wiedererlangt werden müssten. Autoritäre Bedürfnisse ziehen sich kontinuierlich durch die Geschichte der Moderne, das Gefühl des Scheiterns wird auch heute noch an reaktionären Bewegungen schiefgeheilt: die «Manosphere» als Angebot, die inneren Konflikte einer krisenhaften Männlichkeit zu bannen, etwa.
Dem gelte es etwas entgegenzusetzen, auch was die Untergangsrhetorik betrifft. Es stünden in der Gesellschaft ungeahnte Ressourcen zur Verfügung, Reflexionsfähigkeit, Möglichkeiten zur Verständigung. «Dadurch, dass Menschen eben auch in der Lage sind, Begehren und Wünsche zu entwickeln, sie nicht unter Druck kräftiger Zwänge verdrängen müssen, ergibt sich die Perspektive eines gesellschaftlichen Miteinanders», sagt Decker.
«Mitmachen wollte ich nie», hatte Leo Löwenthal gesagt, «‹I prefer not to› ist die Antwort, die die Psychoanalyse, die die Kritische Theorie auf die Fragen der Zeit gibt», sagt Decker. Wenn die anderen in die kollektive Bewegung der Verachtung einschwenkten, schrieb Fleury, müsse man in der Lage sein, Widerstand zu leisten.
Vielleicht kann man das von psychoanalytischem Denken lernen: unabhängig und kritisch bleiben, an einem Nonkonformismus in der eigenen Haltung und im eigenen Handeln festhalten, nicht irrewerden an der «Konstruktion Mensch», wie Theweleit meinte, die eigene Ohnmacht ans Licht holen, «das Leiden beredt werden lassen» (Horkheimer / Adorno) und auch hinhören, wenn es schweigt, sich in individuellen und kollektiven Symptomen ausdrückt.
Vielleicht kann man lernen, sich klar zu werden über die Unversöhntheit, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten der Gesellschaft, des Menschen: Wo etwas komplex, facettenreich und voller Kipppunkte ist, liegt auch Potenzial zur Emanzipation, liegen möglicherweise Lebensgenuss und Glück. Die Psychoanalyse habe sich stets gegen die Illusion einer Kontrollierbarkeit verwehrt, sagt Decker, darin liegt ihr Versprechen, darin, dass alles widersprüchlich ist und sich auch deshalb etwas ändern kann. Wer einen guten Taucheranzug hat, kann auch nach Schätzen tauchen.
