Die Psychoanalyse in Anekdoten WOZ-Autor:innen offenbaren ihr Unterbewusstes

Was da alles zum Vorschwein kommt!
1936 wurde Sigmund Freud für den Literaturnobelpreis nominiert. Seine Texte haben eine Eleganz, wie man ihr selten in wissenschaftlichen Texten begegnet. Das kommt auch in der «Einführung in die Psychoanalyse» zum Ausdruck, die auf Vorlesungen zwischen 1915 und 1917 basiert. Unterhaltsam sind nicht zuletzt seine Überlegungen zu «Fehlleistungen», insbesondere Versprechern, Verlesern und Verhörern. So analysiert Freud den Fall eines Patienten, der von Tatsachen spricht, die «zum Vorschwein gekommen» seien. Oder den eines jungen Mannes, der eine ihm unbekannte Frau «begleitdigen» wollte. Die Devise «Aus Fehlern lernt man» mag billig sein. Bezüglich freudscher Versprecher, -hörer und -leser hat sie eine gewisse Gültigkeit. Indem sich in solchen Fehlleistungen unsere tieferen Absichten, Hoffnungen oder Ängste melden, können sie uns wertvolle Hinweise liefern. Oder wie Freud sagte: «Sie sind nicht Zufälligkeiten, sondern ernsthafte seelische Akte, sie haben ihren Sinn, sie entstehen durch das Zusammenwirken – vielleicht besser: Gegeneinanderwirken zweier verschiedener Absichten.» Eines Tages erzählte mein Vater etwas von «theologischen Handbüchern». Und meine Grossmutter, hellhörig geworden, fragte innert Sekundenbruchteilen: «Was für biologische Handtücher?» Fehlleistungen können überaus fantasievoll sein.
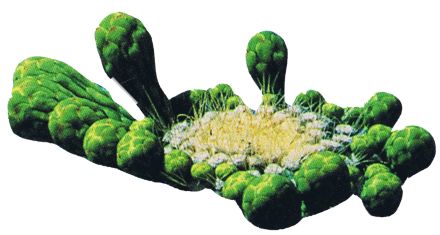
Lesen statt Sprechkur
Der Grund, warum ich nie eine Psychoanalyse gemacht habe, ist ein schmaler Band von Sigmund Freud. Vor etwa dreissig Jahren kaufte ich in einem Brockenhaus seine «Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse». Das Buch gefiel mir nicht schlecht, ja sogar so gut, dass ich immer mehr Bücher von Freud anschleppte. Irgendwann hatte ich fast alles von ihm gelesen und konnte mir nicht mehr vorstellen, diese funkelnde, revolutionäre Theorie auf mein vergleichsweise banales Leben anwenden zu lassen; von einer vermutlich etwas gelangweilten Analytikerin in einer der vielen psychoanalytischen Praxen, die es damals in Zürich gab. Die noble Erklärung lautet also: Eine Psychoanalyse hätte mir die Freude an Freuds Denken verdorben. Etwas weniger fein könnte man aber auch von einer Verweigerung sprechen – oder von einem Unwillen, mich in zig Therapiesitzungen mit mir selber auseinanderzusetzen. Lieber las ich noch ein bisschen weiter: Lacan, all die slowenischen Ableger:innen von Žižek bis Zupančič. Die Zeit verging, und ich merkte, dass all die kleinen Störungen, Knoten und Traurigkeiten zu denjenigen Lasten gehören, die mit dem Alter eher leichter werden; manche so leicht, dass man über sie lachen kann. Und im besten Fall schärft die Abwendung vom eigenen Ich auch den Sinn für andere Verwicklungen und Rätsel.
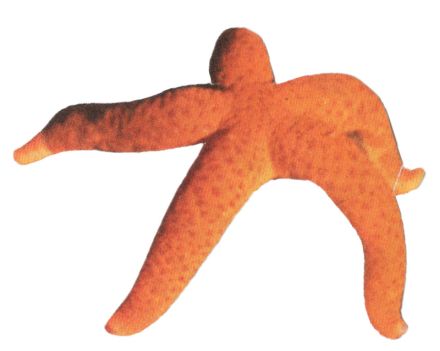
Die Psychoanalyse und die RAF
Meine letzte grosse Recherche hat mich dazu geführt: «Nach dem bewaffneten Kampf» heisst das Buch, 2007 im Psychosozial-Verlag erschienen. Es erzählt von einer besonderen Gruppenarbeit: Fast sieben Jahre lang trafen sich ehemalige Mitglieder der Rote-Armee-Fraktion (RAF), der Bewegung 2. Juni sowie zwei Frauen aus deren Umfeld mit Psychoanalytiker:innen, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. In den Texten blicken die Beteiligten darauf zurück: Es geht um Vertrauen und Verrat, um Politik, Utopie und Traumata, um Gruppendynamiken, Spaltungen und Brüche unter den «Ehemaligen», gezeichnet von Jahrzehnten in Haft. Um das Über-Ich, Rigidität und Härte – mit anderen, mit sich selbst. «Wann immer ich im Freundeskreis meine Arbeit erwähnte, wurde ich überhäuft mit empörten Fragen: Was sagen sie zu den Toten, ihrer Verantwortung, ihren Taten?», berichtet Volker Friedrich, Psychoanalytiker. Ella Rollnik, Bewegung 2. Juni, stellt fest: «Wir mussten uns mit uns selbst auseinandersetzen, weil nur wir mit dem gleichen Erfahrungshintergrund uns und unseren Kampf in Frage stellen konnten.» – «Das Schlimme ist nicht die Niederlage», konstatiert Roland Mayer. «Das Erbärmliche ist der Umgang mit ihr. Das Projekt RAF ist gescheitert, vieles daran war falsch, manches unentschuldbar. Dennoch war der Versuch in dieser Welt richtig.»

Raus aus dem Patientenkollektiv
Leider hat sich die Rapformation Antilopen Gang politisch als deutlich problematischer entpuppt, als ich einst gemeint hatte. Ihr Lied «Patientenkollektiv» war trotzdem programmatisch für meinen Politisierungsprozess: «Die Welt ist krank und sie macht, dass du leidest / du giltst als gesund, wenn du nicht daran verzweifelst.» Irgendwie psychisch krank zu sein, war in meinen Kreisen damals normal. Wer keine Diagnose hatte, war wohl nicht erreichbar für die Not, war nicht radikal genug. Und so bestärkten wir uns gegenseitig darin, irgendwie krank zu sein, weil das richtig schien. Als ich letztens meinem heutigen Analytiker gesagt habe, ich finde es schwierig, mit all dem Elend umzugehen, das auf uns einstürze, belehrte er mich: Das sei kein Problem für die Therapie – ich solle mir doch eine gewaltbereite Kleingruppe suchen. Was die Psychoanalyse sonst aktuell noch so zu Politik und Macht zu sagen hat, ist Ende November Thema des interdisziplinären Kongresses «Zur Macht des Unbewussten in Politik und Subjekt» im Zürcher Volkshaus. Auch Laien seien herzlich willkommen, versichern die Veranstalter. Schon im Vorfeld finden mehrere Veranstaltungen zum Thema statt, organisiert vom Psychoanalytischen Seminar Zürich.
Programm und weiterführende Informationen: www.muub.online

Die Frau mit der goldenen Brille
Vergangenes Jahr ging es mir nicht gut. Ich hatte Stress, konnte nicht schlafen, nichts machte mir mehr Spass. Aber das Schlimmste war: Meine psychische Verfassung hatte meine Redegewandtheit zum Frühstück gefressen. Ständig sah ich mich in der Defensive. Die Sätze, die aus meinem Mund kamen, folgten mir nicht mehr, sondern leiteten mich in die Irre. Sie waren ungelenk formuliert, verharrten im Ungefähren und waren voller Wut. Nachts spürte ich ihnen hinterher, grübelte und schämte mich. Dann kam Frau K., meine Therapeutin mit der goldenen Brille. Sie hörte sich meine empfundenen Peinlichkeiten geduldig an, sortierte nach handelnden Personen, abstrahierte persönliche und strukturelle Probleme («Das Patriarchat! Die Leistungsgesellschaft! Der ganz normale Wahnsinn!»), analysierte meine jeweilige Rolle und meinen Handlungsspielraum. Sie liess mich notieren, was in der Woche zwischen den Sitzungen jeweils gut und was schlecht gelaufen war und warum. Wir setzten dem ewigen Gedankenkarussell, das mich so quälte, etwas sehr Intelligentes entgegen. Unsere gemeinsamen Stunden wurden wie ein Fortsetzungsroman, den wir beide gerne lasen. Irgendwann freute ich mich wieder auf das nächste Kapitel. In dem das, was ich so von mir hörte, einfach okay war. Danke dafür, Frau K.! Anonym

Atemlos durch den Traum
Eine Familienfeier – Anlass unklar – in ausladenden Räumen ohne Tageslicht. Vielleicht sind wir in einer Art Schulaula? Ich sehe meine Eltern irgendwo, alle Versammelten bewegen sich in Richtung eines unbestimmten Ziels. Plötzlich bemerke ich die Schlagersängerin Helene Fischer (an die ich im wirklichen Leben sicher zwei Jahre nicht mehr gedacht habe) in der festlichen Prozession, wir tauschen Blicke aus, sie lächelt mich an. Da liegt was in der Luft! Plötzlich ist da eine Rolltreppe, doch sie bewegt sich viel zu schnell, extrem schnell sogar: Ich schiesse förmlich nach oben und fliege am Ende sicher zehn Meter weit durch die Luft. Mit grosser Kraftanstrengung schaffe ich es, sicher auf beiden Beinen zu landen. Ich drehe mich um, um zu schauen, ob Helene auch gemerkt hat, wie gut ich die Situation gemeistert habe.
Deutung durch WOZ-Redaktor Lukas Tobler: Eine Knacknuss! Klassischerweise geht es bei Träumen um die Erfüllung zensierter Wünsche. Und wer würde sich nicht gern mal mit Helene Fischer auf derselben Rolltreppe befinden? Wobei das Begehren, das hier zum Ausdruck kommt, wohl nicht beim Augenflirt aufhört. Dass der Protagonist derart nach oben schiesst … na ja. Und wieso Fischer? Traumfiguren sind laut Freud oft Teile des Ichs, gewissermassen Abspaltungen. Dass sich dieser Träumende im Superstar wiederfindet, spricht für ein Narzissmusproblem. Da hätte es adäquatere Optionen gegeben, zum Beispiel Baschi.

Das Erstgespräch
Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich zur Königin der psychotherapeutischen Erstgespräche erklärte. Multiple Krisen im jungen Erwachsenenalter hatten mich einst in eine Psychosekte getrieben, in der ich so lange geblieben war, dass mich nach meinem Austritt die Frage umtrieb, welche Persönlichkeitsanteile mich eigentlich dort gehalten hatten. Also machte ich mich auf die Suche nach einer «richtigen» Psychotherapie. Als Erstes war ich bei einem Psychiater. Als ich erwähnte, meine Mutter sei begeistertes NSDAP-Mitglied gewesen, fragte er: «Dass Ihre Mutter den grössten Massenmörder der Geschichte verehrte, irritiert Sie nicht?» Eine Verhaltenstherapeutin bejahte so eilfertig jeden meiner Sätze, dass ich das Gefühl bekam, ich müsse sie stützen. Eine Gestalttherapeutin beharrte darauf, dass etwas, das ich erzählte, nicht stimmen könne. Ein Analytiker sagte mir nach wenigen Minuten: «Sie schauen so bedürftig!» Ich suchte weiter. Als ich bei dem Psychoanalytiker Tilmann Moser las, man solle beim Erstgespräch seinen Gefühlen vertrauen, fuhr ich nach Freiburg und führte ein erleichterndes Gespräch mit ihm. Schliesslich fand ich die Richtige, obwohl sie der Schule von Carl Gustav Jung anhing. Gemeinsam kamen wir zum Schluss: Die Richtung ist eigentlich egal – Hauptsache, die Beziehung haut hin.