3. Draussen die Welt Befreiungskämpfe und Entwicklungskonzepte

Das Quartier Les Pâquis zwischen Bahnhof und See ist so etwas wie das multikulturelle Herz Genfs: Die Schulkinder hier kommen aus 73 Nationen, rund sechzig Prozent der Bevölkerung haben keinen Schweizer Pass. Es ist ein Quartier ganz nach dem Geschmack von Ruth Dreifuss. Spaziert man mit ihr durch die Strassen im Pâquis zum nächsten Sushiladen, wird sie von allen Seiten her begrüsst. Nicht als berühmte Politikerin, sondern als vertraute Nachbarin. Betritt man ihre Dachwohnung, fallen gleich am Eingang zwei vergilbte Fotografien auf: Nelson Mandela ist darauf zu sehen und Mahatma Gandhi, zwei ihrer grossen Ikonen. «Und seht ihr dort vorne? Da befindet sich das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte», sagt sie auf dem Balkon. Pâquis, Genf und die Welt: Was Ruth Dreifuss antreibt, muss man sich immer vor einem internationalen Horizont vorstellen.
Schon als Jugendliche faszinieren sie die antikolonialen Befreiungsbewegungen, die sich gegen die kapitalistischen Zentren erheben. Es ist das Jahr 1954, als sie im Radio einen bemerkenswerten Satz des soeben zum französischen Premier gewählten Sozialisten Pierre Mendès France hört: Innert zwanzig Tagen werde er den Indochinakrieg gegen die vietnamesischen Kommunist:innen beenden. Bei Dreifuss hinterlässt die Entschlossenheit bleibenden Eindruck, voller Bewunderung beobachtet sie, wie der Politiker – bloss acht Monate an der Macht – Vietnam, Laos und Kambodscha in die Unabhängigkeit entlässt sowie jene von Tunesien und Marokko vorbereitet. «Pierre Mendès France, das war einer meiner grossen Helden», schwärmt sie. In einer bemerkenswert offenen politischen Sprache legte er regelmässig Rechenschaft über seine Amtsführung ab. Als er nach Genf kommt, ist Ruth vierzehn, sie schwänzt die Schule, um ihn im Palais des Nations aus der Nähe zu erleben. «Kennt ihr etwa Mendès France nicht mehr?», unterbricht sie plötzlich das Gespräch. «Was seid ihr nur für Deutschschweizer!»
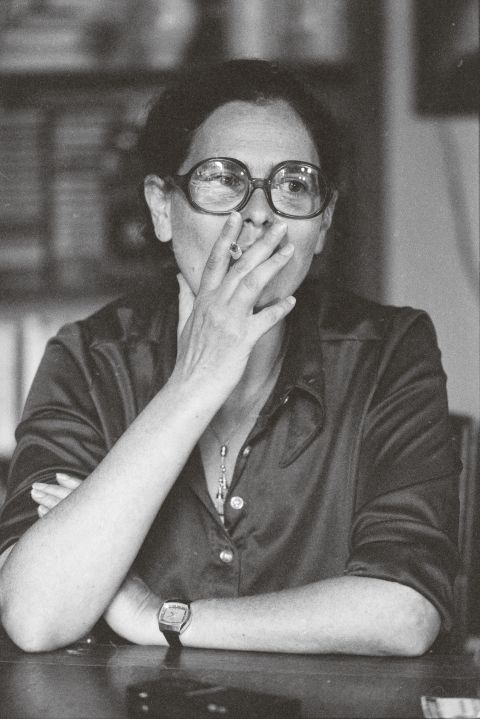
Dreifuss wird eine aktive «Tiersmondialistin», eine, die sich für die Belange der sogenannt Dritten Welt, des Globalen Südens einsetzt. Eine prägende Rolle spielt dabei auch ein Dominikanerpriester: Pater Jean de la Croix Kaelin. Mit seiner Vespa schmuggelt er immer wieder algerische Widerstandskämpfer:innen und französische Deserteure, die nicht für die Kolonialmacht im Algerienkrieg kämpfen wollen, über die Grenze in die Schweiz. Sein Centre universitaire catholique, das katholische Student:innenwohnheim, ist eine politische Drehscheibe: Dort kommt Dreifuss mit unterschiedlichsten Leuten in Kontakt, mit Journalistinnen, Funktionären internationaler Organisationen, Mitgliedern des Front de libération nationale, der zu jener Zeit in Algerien für die Unabhängigkeit kämpft.
Dreifuss wird selbst tätig: Auch sie schmuggelt Anfang der sechziger Jahre Flüchtende, die nicht in den Krieg wollen, und Oppositionelle aus den Diktaturen in Spanien und Portugal in die Schweiz, bringt politische Aktivist:innen bei sich unter. «Ich kannte die Grenze mittlerweile nicht schlecht und hatte den Eindruck, meinem Vater treu zu sein mit diesem Einsatz», so erzählt sie es in der 2002 veröffentlichten Biografie «Dreifuss ist unser Name» von Isabella Fischli, die die Geschichte der Familie und von Ruth Dreifuss bis zur historischen Wahl detailliert nachzeichnet. Die elterliche Wohnung in der Rue de Lausanne, in der sie in jener Zeit immer noch lebt, wird zur Durchgangsstation. Auch die Ärztin Annette Beaumanoir, die in der Résistance kämpfte, jüdische Familien rettete und dann den algerischen Befreiungskampf im Untergrund unterstützte, wohnt zwei Jahre lang bei Dreifuss.
Ergänzt wird der Blick nach Süden früh von einem Interesse für den Osten. Durch die Arbeit ihrer Mutter kommt Dreifuss mit Geflüchteten aus Ungarn in Berührung. Ihre tief sitzende Abneigung gegen alles Totalitäre ermöglicht ihr auch ein kritisches Verständnis des Realsozialismus. Wo manche Linke damals noch die Systemalternative romantisieren, sind für Ruth Dreifuss die Prinzipien längst ausgemacht, die Kunde über den sowjetischen Gulag bringt die letzte Klarheit: «Etwas anderes als die Verteidigung der Dissident:innen kam für mich nicht infrage.»
So viel Weltläufigkeit sie damals in Genf umgibt, so internationalistisch sie selbst denkt – aus der Schweiz hinaus kommt sie in ihren ersten dreissig Lebensjahren fast nie. 1971 will sie das endlich ändern: In Chile ist bei den Wahlen im Jahr davor die Unidad Popular von Salvador Allende an die Macht gekommen. Allende, auf dem die Hoffnungen progressiver Linker rund um den Globus ruhen, will im lateinamerikanischen Land seine Vision eines demokratischen Sozialismus verwirklichen. Auch Genossin Ruth aus Genf will das Wissen anbieten, das sie sich soeben in einem Wirtschaftsstudium angeeignet hat. «Ich schrieb verschiedene Briefe nach Chile, dass ich mich gerne in den Dienst der Regierung stellen möchte. Leider kam nie eine Antwort.» Aber vielleicht gäbe es ja einen anderen Weg zur Unidad Popular?
Sie spricht beim Dienst für technische Zusammenarbeit (DftZ) in Bern vor, aus dem später die Deza wird. Zwar kann dieser keine Stelle in Chile vermitteln, doch wird Dreifuss immerhin in der Lateinamerikasektion angestellt. «Es war die Arbeitsgemeinschaft, in der ich mich am meisten zu Hause fühlte», erinnert sie sich, «geprägt von einem schönen Zusammenhalt, den man nicht unbedingt von einer eidgenössischen Verwaltung erwartet.»
Jacques Forster leitete die Sektion, in die Dreifuss kam. Später wurde er Direktor des Genfer Institute of Development Studies und Vizepräsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. «Sie hat stets viel Zeit und Intellekt in ihre Arbeit investiert», erinnert er sich am Telefon. Schnell habe sie beim DftZ wichtige Aufgaben übernommen, sich um die Beziehungen zwischen Schweizer Unis und Entwicklungsländern gekümmert – und an jenem Gesetz mitgearbeitet, das fortan die rechtliche Grundlage für die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit bilden sollte.
Dreifuss sei sich deren beschränkter Wirkung sehr bewusst gewesen, sagt Forster. Früh habe sie verstanden, dass etwa Handels- und Finanzbeziehungen einen viel grösseren Einfluss auf die Lebensumstände der Leute hätten. Es sei ihr aber auch um ein anderes Konzept von Entwicklung gegangen. «Nicht nur darum, die materielle Situation der Leute zu verbessern, nicht nur um den Zugang zu Essen. Das Schlüsselwort ist Menschenwürde, dass Menschen die Möglichkeit erhalten, in Freiheit zu leben – und das nicht nur auf dem Papier.» Der Kampf für Würde sei ihr immer das zentrale Anliegen gewesen, sagt Forster, den mit Dreifuss bis heute eine enge Freundschaft verbindet.
Endlich kann Dreifuss auch in die weite Welt hinaus reisen. Sie betreut hauptsächlich Hilfsprojekte in lateinamerikanischen Staaten wie Brasilien. 1973 wird sie zum ersten Mal nach Haiti geschickt – und besucht das Land daraufhin jährlich. Wie stark die Erlebnisse sie prägten, beschreibt eine Freundin in Fischlis Biografie: «Als Ruth zurückkam, war sie fast krank vor Schmerz über das schreiende Unrecht, das sie dort gesehen hatte, die Not, den Graben zwischen Arm und Reich.»
In Haiti freundet sich Dreifuss mit den Unterstützer:innen von Jean-Bertrand Aristide an – und mit dem charismatischen Prediger selbst. Dieser kämpft gegen die brutale Diktatur der Familie Duvalier, die jahrzehntelang an der Macht bleibt und dabei nicht nur das Land ausraubt, sondern auch Zehntausende politische Gegner:innen verfolgen und ermorden lässt. 1990, nachdem Aristide selbst bei der ersten demokratischen Wahl zum Präsidenten gewählt wird, bittet er Dreifuss zum Gespräch über die anstehenden Regierungsaufgaben nach Porte-au-Prince.
Die Entwicklungszusammenarbeit selbst hat sie zu diesem Zeitpunkt längst aufgegeben. Gerade die Mission in Haiti hat eine tiefe Krise in ihrem Selbstverständnis ausgelöst. «Verantwortung zu tragen, bedeutet, an dem Ort ein Risiko einzugehen, an dem man selbst auch tätig ist», erklärt sie heute. «Bei der Entwicklungszusammenarbeit ist es aber anders: Wenn etwas vor Ort schieflief, war ich sicher in der Schweiz, die Konsequenzen betrafen mich nicht, während die Menschen, die ich dort kennengelernt hatte, die Leidtragenden waren.» Eine Rolle spielt für Dreifuss auch eine zweite Empfindung: «Bei vielen Projekten hatte ich im Nachhinein – zum Teil berechtigt und zum Teil nicht – Zweifel an ihrer Nützlichkeit, daran, dass die Umsetzung auf Augenhöhe geschah.»
Beide Überlegungen bringen Dreifuss dazu, ihren Job an den Nagel zu hängen. «Ich wollte Teil einer Bewegung sein, bei der ich, wenn ich etwas falsch mache, auch direkt den Rüffel bekomme. Ich wollte wieder in der Schweiz tätig sein, weil ich hier über mein Handeln Rechenschaft ablegen muss», erinnert sie sich. Dreifuss bewirbt sich als Zentralsekretärin beim Gewerkschaftsbund – und gewinnt die Kampfwahl gegen einen Mann.
