5. Die doppelbödigen Neunziger Den Sozialstaat verteidigen
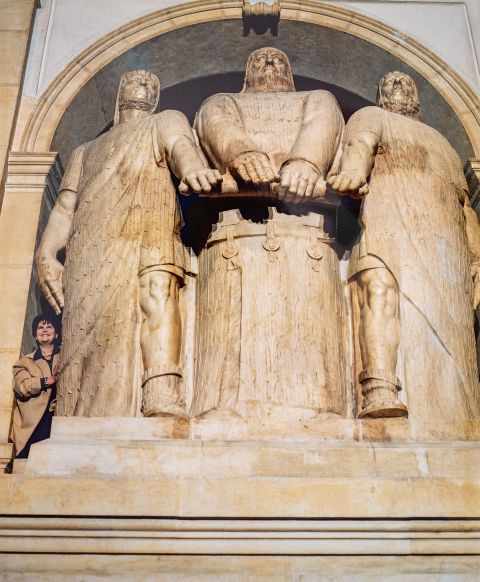
Eines der liebsten politischen Werkzeuge von Ruth Dreifuss ist das Briefeschreiben. Als sie neu im Bundesrat ankommt, nutzt sie gleich das schöne, neue offizielle Briefpapier: Wann immer sie Informationen über ausgesprochene Todesstrafen erhält, schickt die Ministerin der verantwortlichen Regierung eine Protestnote.
Einen Brief schreibt Dreifuss auch im Mai 1994. Diesmal nicht an ferne Machthaber, sondern via Medien an die eigene Bevölkerung. «Sehr geehrte Damen und Herren», beginnt das Schreiben harmlos. In den letzten Wochen hätten sich die Gerüchte gehäuft, wonach die Kassen der AHV bald leer seien. «Das Eidgenössische Departement des Innern erhält jeden Tag Briefe von verängstigten Menschen, die um ihre Rente bangen. Wenn ich etwas verwerflich finde, dann den Missbrauch der Angst in der Politik.» Die Botschaft, die Dreifuss mit ihrem Brief verbreitet: «Die AHV ist nicht in Gefahr.» Die Finanzierung der Altersvorsorge sei bis ins Jahr 2000 gesichert, eine Erhöhung des Rentenalters nicht nötig.
Bürgerliche Politiker wie FDP-Präsident Franz Steinegger reagieren erbost auf den Brief («naiv und schwachsinnig»), der Bundesrat rüffelt die Kollegin («Zweifel über den eingeschlagenen Weg, um es milde auszudrücken»). Kein Wunder, denn die Botschaft des Briefes steht quer zum politisch forcierten Neoliberalismus der neunziger Jahre – jenes Jahrzehnts, in dem sich auch die Schweiz nach dem Kalten Krieg neu orientieren muss. Jakob Tanner nennt es ein «Transformationsjahrzehnt mit widersprüchlichen Dynamiken», in dem um verschiedene Vorstellungen von der Schweiz zwischen Öffnung und Sonderfall gerungen wird.
Eingeläutet wird die Epoche 1989 mit der Aufdeckung des «Fichenstaats», der soziale Bewegungen, linke Politiker, Gewerkschafterinnen und Intellektuelle überwacht, viele davon ohne Schweizer Pass. 1991 folgt der Frauenstreik, ehe die Schweiz ein Jahr später den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum ablehnt – die SVP erstarkt.
Zwar gelingen in einem Bündnis von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden die bilateralen Verträge mit der EU, deren flankierende Massnahmen den Lohndruck innenpolitisch abfedern. Die Absage an den europäischen Binnenmarkt und eine Immobilienkrise führen vorerst allerdings in eine harte Rezession. Die Arbeitslosigkeit steigt von 0,5 Prozent im Jahr 1990 auf über 5 Prozent auf dem Höhepunkt sieben Jahre später. «Die Schweiz hatte die schwerste Stagnationszeit in ganz Europa», bilanziert Tanner. In dieser Zeit werden die neoliberalen Rezepte, die erst in den Staaten des früheren Ostblocks erprobt wurden, von Wirtschaftsführern und -professoren in einem Büchlein mit dem Titel «Mut zum Aufbruch» auch in der Schweiz propagiert. Und mittendrin im Getümmel: Ruth Dreifuss, die als Sozialministerin eine ganz andere Agenda verfolgt. Wobei sie dafür erst einmal das sozialpolitisch wichtige Innendepartement für die SP gewinnen musste.
Will man erfahren, wie sie das geschafft hat, reist man am besten nach Kandersteg, wo der frühere SVP-Bundesrat Adolf Ogi mit dem Velo beim Landgasthof Ruedihus vorgefahren ist. Und schon zur Begrüssung sagt: «Ich liebe Ruth! Ich liebe sie in Anführungszeichen.» Er anerkenne alles, was sie gemacht habe. «Dass sie nicht die bürgerliche Politik betreiben kann, wie sie der Ogi betreibt, das wusste ich. Aber die Menschlichkeit, die Zuverlässigkeit, die Intelligenz, die Schaffenskraft, die Geradlinigkeit haben mich beeindruckt.» Schon vor der ersten Sitzung zur Departementsverteilung habe er Dreifuss in eine Wirtschaft ins Emmental eingeladen, um sie in die Bundesratskunst einzuführen, erzählt Ogi. «Ich habe für sie sogar ihre zukünftigen Kollegen richtiggehend durchleuchtet, eine Art Röntgenbild von ihnen gemacht.»

Dass ihr dann am Ende der Sitzung, die bis nach Mitternacht dauert, tatsächlich das EDI zufällt – dafür kommt ihr ein Streit zwischen den damaligen CVP-Bundesräten Arnold Koller und Flavio Cotti zupass. Beide wollen unbedingt Aussenminister werden und können sich partout nicht verständigen. «Zuerst ging Stich als Ältester mit ihnen raus: Keine Einigung», erinnert sich Ogi. «Dann ging ich mit ihnen raus als Bundespräsident: Immer noch keine Einigung.» Da habe er vorgeschlagen, dass «wir andern fünf» entscheiden sollten. Mit den Stimmen der Sozialdemokrat:innen und von Ogi – «Ich brauchte Cotti für die Neat» – übernimmt der bisherige Innenminister aus dem Tessin das Departement des Äussern. Und das Innendepartement geht an Dreifuss.
Als sie nach hundert Tagen vor die Presse tritt, nennt sie das EDI «département de la vie quotidienne», Departement des Alltags. «Ich hatte die Bezeichnung gewählt, weil es sich um die Fragen des täglichen Lebens dreht, Gesundheit, Ausbildung, Altersvorsorge. In meinen Augen um Sachen, die die Leute direkt betreffen», sagt sie heute. Manchmal nennt sie das EDI auch «département de la modernité», Departement der Neuartigkeit: Denn hier werden auch alle neuen Fragen angesiedelt, die nicht in den klassischen Staatsaufbau von Finanzen, Aussenpolitik, Justiz und Militär passen. Dazu gehört auch der Umweltschutz: Nach dem grossen Erdgipfel der Uno in Rio 1992, an dem die internationale Klimapolitik ihren Anfang nimmt, wird Dreifuss ein erstes CO2-Gesetz ins Parlament bringen.
Sozialpolitisch sind es in den neun Jahren ihrer Amtszeit vor allem drei Vorlagen, die sie mitprägt: das Krankenversicherungsgesetz, die 10. AHV-Revision und die Mutterschaftsversicherung. Alle drei versuchen, Diskriminierungen in der sozialen Absicherung abzubauen, die insbesondere Frauen betreffen. Und alle drei sind mit Abstrichen Erfolge. Das Krankenkassenobligatorium bringt einen Versicherungsschutz für alle Einwohner:innen. Doch im Projekt, das Dreifuss noch von ihrem Vorgänger Cotti übernommen hat, werden die Prämien nicht einkommensabhängig ausgestaltet. Die 10. AHV-Revision macht die Frauen endlich zu autonomen Subjekten in der Rentenversicherung und führt Erziehungsgutschriften ein, um ihre Betreuungsarbeit zu honorieren. Dreifuss kann dabei auf Vorarbeiten in den Frauenkommissionen der Gewerkschaften zurückgreifen, an denen sie selbst beteiligt war. Gleichzeitig bürdet das Parlament den Frauen zwei Arbeitsjahre mehr zur Rente auf, was die Linke spaltet: Die SP mit Dreifuss ist in der Abstimmung trotzdem dafür, die Gewerkschaften mit Christiane Brunner sind dagegen. Dreifuss setzt sich durch.
Eine Mutterschaftsversicherung von sechzehn Wochen schliesslich wird abgelehnt, doch ist damit der Boden für eine spätere Einführung gelegt. «Bei allem, was man hätte besser machen können und müssen, würde ich die drei Beispiele als positiv betrachten, weil damit am Ende wichtige Lücken bei den Sozialversicherungen geschlossen wurden», sagt Dreifuss heute. Viel mehr ärgere sie, dass sie bei der Invalidenversicherung kaum weitergekommen sei.
Paul Rechsteiner wird in den neunziger Jahren Präsident des Gewerkschaftsbunds und steht als solcher in einem engen Austausch mit Dreifuss. «Wenn etwas herausragt, auch im Weltmassstab, speziell im Vergleich mit den USA, dann ist es das Krankenkassenobligatorium. So stossend die Finanzierungsprobleme bis heute sind – der Zugang zu fast allen medizinischen Leistungen für alle bleibt einzigartig. Das ist hohe sozialdemokratische Arbeit.» Eine weitere geschickte Tat von Dreifuss sei es gewesen, bei einer Pensionskassenreform den Umwandlungssatz ins Gesetz zu schreiben. «Die Bürgerlichen haben nicht aufgepasst, seither kann jede Rentensenkung mit dem Referendum in einer Volksabstimmung bekämpft werden.»
Die ehemalige Chefredaktorin der Gewerkschaftszeitung «work» Marie-Josée Kuhn hat zum Rücktritt der Sozialministerin 2002 unter dem Titel «Die Revolution Dreifuss» eine bis heute lesenswerte Bilanz geschrieben. «Als ‹Verteidigungsministerin› war Dreifuss einsame Spitze», sagt sie am Telefon. «Der bürgerliche Sparangriff auf die Sozialversicherungen hat ausser beim Frauenrentenalter wenig Wirkung gezeigt.» Gleichzeitig jedoch habe sich Dreifuss von einem schwarzmalerischen Bericht über die Finanzierung der Sozialwerke in die Defensive treiben lassen und die falschen Prognosen übernommen. «Da hat sie strategisches Potenzial verspielt.»
Historikerin Elisabeth Joris betont, es sei Dreifuss gelungen, «Fortschritte zu implementieren, die in den Neunzigern quer zum Mainstream lagen». Gerade auch im Vergleich zu Deutschland und Grossbritannien, wo damals auf dem «Dritten Weg» auch die Sozialdemokratie den Abbau mittrug. «Und was passiert in der Schweiz? Da haben wir staatliche Regulierungen für eine sozialere Politik.»
So hart rechte Politiker:innen und viele Medien Ruth Dreifuss damals angegangen sind, so versöhnlich geben sie sich heute. «Sie hatte im Bundesrat unzweifelhaft eine starke Stellung, sonst hätte sie ihre Geschäfte nicht aus der Minderheit heraus durchgebracht», sagt Franz Steinegger. Mit Adolf Ogi verbindet sie bis heute eine Freundschaft. Noch immer erzählt der SVPler gerne, dass er den Bundesrat einst in einer hitzigen Budgetberatung zur Klausur aufs Berner Schilthorn führte. Wenn es später in der Regierung nicht vorwärtsgegangen sei, habe Dreifuss jeweils «Schilthorn, Schilthorn, Schilthorn» gerufen.
