Im Unbewussten einer Stadt An kaum einem anderen Ort hinterliess die Psychoanalyse so viele Spuren wie in Zürich. Wo steht sie dort heute?

125 Jahre nach ihrer Entstehung hat die Psychoanalyse noch immer den Ruf, elitär zu sein. Sigmund Freud, ihr Urvater, war sich des Problems bewusst. In einem Vortrag zu Kriegsneurosen am 5. Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) im September 1918 in Budapest sagte er: «Gegen das Übermass von neurotischem Elend […] kommt das, was wir davon wegschaffen können, quantitativ kaum in Betracht. Ausserdem sind wir durch die Bedingungen unserer Existenz auf die wohlhabenden Oberschichten eingeschränkt […]. Für die breiten Volksschichten, die ungeheuer schwer unter den Neurosen leiden, können wir derzeit nichts tun.»
Es ist auch schwierig zu erklären, worum es bei dieser Wissenschaft überhaupt geht und worauf ihre therapeutische Methode beruht: Da liegt also ein Mensch auf einer Couch. Und schräg hinter ihm auf einem Sessel sitzt jemand, der aus dem, was der Liegende erzählt, herauszufinden versucht, was warum aus dessen Bewusstsein verschwunden ist – um dieses «Unbewusste» über viele Monate, vorzugsweise in mindestens drei Sitzungen pro Woche, wieder ins Bewusstsein zurückzuholen.
«Alles, was ab der Geburt bis zur Adoleszenz für das Bewusstsein untragbar ist, wird verdrängt», sagt Emilio Modena. Der 84-jährige Psychoanalytiker vergleicht das mit einem Eisberg: «Ein Achtel Bewusstes ist sichtbar, der Rest liegt unter der Meeresoberfläche. Deshalb braucht es so lange bei einer Analyse: weil es so viele Widerstände gibt. Alles, was im Lauf der Sozialisation unbewusst wurde, wehrt sich dagegen, bewusst zu werden.»
In Modenas Praxis im ehemaligen Zürcher Industrieviertel hängt ein Bild von Karl Marx. Nicht von Freud, wie man es vielleicht erwartet hätte. Wir befinden uns in der Praxisgemeinschaft der Stiftung für Psychotherapie und Psychoanalyse. 1979, bei deren Gründung, ging es Modena und seinen Genoss:innen darum, die Psychoanalyse der Arbeiter:innenklasse zugänglich zu machen. Und damit verbunden: das Bewusstsein des Proletariats mit den Mitteln der Psychoanalyse zu erforschen. «Marx hat die Gesetzmässigkeiten des Kapitals zutreffend beschrieben», sagt Modena. «Aber den real existierenden Menschen, der die Revolution hätte machen sollen, kannte er nicht. Dafür braucht es die Werkzeuge der Psychoanalyse.»
Wiedererwachen nach dem Krieg
Psychoanalyse als revolutionäres Werkzeug? Um den historischen Hintergrund zu verstehen, vor dem Modena und seine Genoss:innen Ende der siebziger Jahre ihre Praxisgemeinschaft eröffneten, hilft ein Blick noch weiter zurück. 1949 findet erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein Kongress der IPV statt, diesmal in Zürich. Zwei Jahre später beschliesst eine kleine Gruppe hiesiger Analytiker:innen, ein «Schweizerisches Psychoanalytisches Lehrinstitut» aufzubauen. Doch der Anlauf versandet.
Bis dahin gab es in der Deutschschweiz keine offizielle Ausbildungsstätte in freudscher Psychoanalyse. Dabei hatte Freud selbst 1910 ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, das Zentrum seiner Lehre nach Zürich zu verlegen. In Carl Gustav Jung, diesem «Christen und Pastorensohn», der damals am Burghölzli, der heutigen Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, arbeitete und in einer vielbeachteten Studie Freuds Theorie der Verdrängung bestätigte, erhoffte er sich jemanden zur Seite, mit dessen Unterstützung er die Psychoanalyse davor bewahren könnte, nur «eine jüdische nationale Angelegenheit» zu werden.
Doch 1913, nachdem Jung Freuds Libidobegriff kritisiert hatte, weil er ihm zu sehr vom Sexualtrieb geprägt schien, kam es zum Bruch zwischen den beiden. Zwanzig Jahre später wird es ausgerechnet Jung sein – der in Briefen von einem «arischen Bewusstsein» fantasiert, das ein «höheres Potenzial als das jüdische» habe –, der den Vorsitz der von den Nazis gleichgeschalteten Überstaatlichen Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie übernimmt.
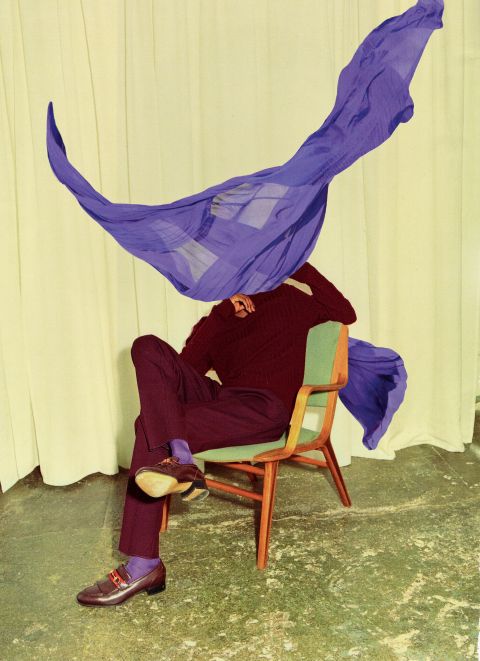
Während sich Jungs «Analytische Psychologie» über all die Jahre weiterhin regen Zulaufs erfreut, macht sich die freudsche Psychoanalyse in Zürich erst wieder ab den späten vierziger Jahren bemerkbar: Im Burghölzli führen Gustav Bally und der spätere Daseinsanalytiker Medard Boss Assistenzärzte in die entsprechenden Techniken ein. Die gesellschaftlich nachhaltigeren Impulse jedoch kommen von ausserhalb der Institutionen: Zur selben Zeit bildet sich um Fritz Morgenthaler, Paul Parin und Goldy Parin-Matthèy ein privater Kreis junger, engagierter Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse (SGP, später SGPsa): das sogenannte Chränzli.
Das Rüstzeug, mit dem die drei Pionier:innen 1952 am Utoquai eine Praxisgemeinschaft eröffnen, ist bemerkenswert: Parin, der in Slowenien aufgewachsen war, leistete als junger Arzt in Titos Partisanenarmee bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs medizinische Dienste; Parin-Matthèy beteiligte sich im Spanischen Bürgerkrieg am Sanitätsdienst der Internationalen Brigaden, war im jugoslawischen Bürgerkrieg in einem Spital tätig und half 1946 zusammen mit Morgenthaler, in Nordbosnien eine Poliklinik aufzubauen. Nach Abschluss ihrer psychoanalytischen Ausbildungen unternahmen alle drei zusammen ethnologische Forschungsreisen nach Westafrika – und begründeten so die deutschsprachige Tradition der Ethnopsychoanalyse.
In diesen Jahren blühten in Zürich etliche tiefenpsychologische Schulen: Alfred Adlers Individualpsychologie, Leopold Szondis Schicksalsanalyse oder Medard Boss’ Daseinsanalyse, die bis heute eigene Institute in der Stadt haben. Eine besondere Rolle spielte der Adler-Schüler Friedrich Liebling, dessen «Zürcher Schule» sich zum Ziel setzte, Psychologie allen Schichten zugänglich zu machen – primär über psychologische Hilfe und Bildung, die eine kritische Auseinandersetzung mit autoritären und religiösen Strukturen beinhaltete. Sie verstand sich zudem als Lebens- und Forschungsgemeinschaft sowie als Modell dafür, wie sich moderne psychologische Erkenntnisse, ein Umgang in Gleichheit und gegenseitiger Hilfe in der Praxis umsetzen lassen. In den siebziger Jahren wuchs sie, ab 1974 als Stiftung, zur grössten psychologischen Bewegung im deutschsprachigen Raum. Der Zürcher Historiker Peter Boller rekonstruierte im diesjährigen «Zürcher Taschenbuch», wie nach Lieblings Tod 1982 drei Mitglieder des Stiftungsrats – in Missachtung der Nachfolgeregelung und trotz des Widerstands langjähriger Mitarbeiter:innen – die Leitung übernahmen. Diametral zur linkslibertären Idee Lieblings entstand 1986 der rechtskonservative Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis (VPM).
Antiautoritärer Aufbruch
1958, als das wiedererwachte Interesse an der Psychoanalyse immer weitere Kreise erfasste, entstand aus dem «Chränzli» das Psychoanalytische Seminar für Kandidaten (PSZ), das 1961 von der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) als Ausbildungsinstitut anerkannt werden sollte. Die Art, wie dabei Psychoanalyse vermittelt wurde, unterschied sich, von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung stillschweigend akzeptiert, von anderen Instituten: Kandidat:innen konnten auch ohne Abschluss in Medizin oder Psychologie die Ausbildung antreten und mussten kein Aufnahmeprozedere durchlaufen.
Der Geist der 68er erfasste die Psychoanalyse und das PSZ. Lange Zeit unzugängliche Schriften der freudschen Linken um Wilhelm Reich begannen in Raubdrucken zu zirkulieren, die Debatten um Marxismus (als kritische Theorie der Gesellschaft) und Psychoanalyse (als kritische Theorie des Subjekts) wurden wieder aufgenommen. Die Psychoanalyse erlebte ihre goldenen Jahre.
1968 organisierten Berthold Rothschild, Ilka von Zeppelin und Harold Lincke im PSZ ein Seminar über «Psychoanalyse und Gesellschaft». In der Folge wurde Anfang 1969 zur «1. Europäischen Tagung junger Psychoanalytiker» nach Zürich eingeladen. Vertreter:innen aus Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz bereiteten sich dabei auf einen Gegenkongress zum Internationalen Psychoanalytischen Kongress in Rom vor. Aus der Bezeichnung «The Platform – Working Groups of European Psychoanalysts» entstand der Name «Plattform». Der Plattform-Gruppe in Zürich, deren politisches Spektrum von linksliberal bis marxistisch reichte, gelang es in den folgenden Jahren, die Mitbestimmung im Seminarbetrieb durchzusetzen. Ab da lag die Verantwortung für Betrieb und Ausbildung beim Teilnehmer:innenkollektiv, das sich aus Studierenden («Kandidat:innen») und Mitgliedern der Psychoanalytischen Gesellschaft zusammensetzte.
Im Juni 1977 jedoch kommt es zum Bruch mit der SGPsa: «Eines Tages», erinnert sich Emilio Modena, «standen wir vor verschlossener Tür. Die SGPsa als Mieterin der Seminarräume hatte das Schloss ausgewechselt. Da sagten wir uns: Also gehen wir halt – und führen unser selbstverwaltetes PSZ autonom weiter.» Das war der Moment, da sich die Freudianer:innen in der Schweiz aufspalteten: in das PSZ und das kurz darauf im Seefeld eröffnete Freud-Institut als Ausbildungszentrum der SGPsa.
Psychoanalyse fürs Volk?
Die Psychoanalytikerin Ita Grosz-Ganzoni (81) stiess als junge Mutter und Primarlehrerin Anfang der siebziger Jahre zum Seminar und beteiligte sich bald auch in der Plattform-Gruppe. 1977, beim Bruch mit der SGPsa, war sie Teil der Seminarleitung. «Immer spielten da auch Grössenfantasien mit. Wir glaubten, eine wahrhaft psychoanalytische Ausbildung könne nur in freier, möglichst unstrukturierter Form geschehen – auch in Abgrenzung zum Staat.»
Zu jener Zeit gab es einen veritablen «Psychoboom». Neben den institutionalisierten tiefenpsychologischen Strömungen florierten neue Richtungen wie die Humanistische Psychologie oder die Transaktionsanalyse nach Eric Berne. «Damals», so Grosz-Ganzoni, «haben wir uns resolut von anderen Psychologien abgegrenzt.» Etwas gelockert habe sich das erst 1992 durch die Mitwirkung an der Charta, in der psychotherapeutische Institute über verschiedenste Richtungen hinweg gemeinsame Standards zu Weiterbildung, Wissenschaftlichkeit und Ethik definierten. Für das PSZ ging es dabei darum, bei den anstehenden gesetzlichen Regelungen der psychologischen Berufe mitwirken zu können, die schon seit den siebziger Jahren wie ein «Damoklesschwert» (Grosz-Ganzoni) über dem Seminar schwebten.
Die Psychoanalyse «unters Volk» zu bringen, war in der Plattform-Gruppe schon früh ein Thema: «In den Siebzigern arbeiteten wir mit Gefangenen, in Heimen oder antiautoritären Kindergärten», sagt Grosz-Ganzoni. Das Dilemma zwischen dem Anspruch, sich autonom zu organisieren und doch eine breite gesellschaftliche Wirkung zu entfalten, blieb aber – und damit auch die Kluft zwischen der Realität einer exklusiven Psychoanalyse für Vermögende und dem Wunsch, sie zu demokratisieren.
Psychoanalyse für alle: Das war ja auch der Beweggrund für die Stiftung, die Emilio Modena in den späten siebziger Jahren mitgründete. «Entgegen der verbreiteten Ansicht, Menschen ohne intellektuelle Ausbildung seien für eine Psychoanalyse ungeeignet, waren wir klar der Meinung: Man kann jeden Menschen analysieren», erzählt er. «Das Problem war ein anderes: das Geld. Wer kann sich schon eine klassische Analyse leisten? Also studierte ich das Gesetz und sah: Ärzte dürfen Physio- und Ergotherapeuten anstellen – warum nicht auch Psychotherapeutinnen?» Mithilfe von Patient:innen erreichte die Stiftung 1981 in zwei Pilotprozessen vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht, dass auch solche Therapieformen in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen wurden. «Ausbeutungsverhältnisse zwischen ärztlichen und nichtärztlichen Therapeut:innen in unserer Praxisgemeinschaft verhinderten wir, indem alle gleichberechtigt und Ärzt:innen in der Minderheit waren. So konnten nichtärztliche Therapeut:innen alles, was sie verdienten, selber verrechnen, ohne einen Teil davon einem ärztlichen Kollegen abgeben zu müssen.»
Krise im neoliberalen Zeitalter
Wie aber steht es mit dem Vorhaben der Stiftung, das «Bewusstsein des Proletariats» zu erforschen? Taugt Psychoanalyse wirklich als «Fortsetzung der Guerilla mit anderen Mitteln», wie Goldy Parin-Matthèy einst behauptete? Oder wenigstens dazu, die Menschheit ein wenig freier, gerechter und friedlicher zu machen? «Nein», sagt Modena. «In Bezug auf revolutionäre Veränderung bringt Psychoanalyse nichts. Aber als Werkzeug dafür, unbewusste Komplexe ins Bewusstsein zu heben, kann sie emanzipatorisch wirken. Wenn ich einen Lehrer in der Analyse habe, und es gelingt, dass er sich von Zwängen befreit, kann er ein besserer Lehrer sein – und auch seinen Schüler:innen mehr Freiheiten und Entfaltung ermöglichen. Je mehr Menschen Zugang zur Psychoanalyse haben, desto eher kann sie die Vielfalt menschlicher Möglichkeiten vergrössern.»
Im öffentlichen Bewusstsein jedoch, speziell auch im Gesundheitswesen, hat die Psychoanalyse spätestens seit den neunziger Jahren an Bedeutung verloren. Im Lehrplan der Psychologie an der Universität Zürich wird sie mit keinem einzigen Wort erwähnt. Beachtung findet sie höchstens in diversen Kultur- und Sozialwissenschaften als eines unter vielen methodischen Werkzeugen. Was erzählt das über Zürich, wo es von psychoanalytischen Praxen nur so wimmelt?
Im Freud-Institut, dem offiziellen Ausbildungszentrum der Schweizerischen Psychoanalytischen Gesellschaft, empfängt Susanne Richter, die Präsidentin des Instituts. Sie selbst absolvierte ihr Psychologiestudium in den frühen Achtzigern noch am Institut für Angewandte Psychologie – dem ersten Ort in Zürich, wo man das überhaupt im Hauptfach studieren konnte –, bevor sie sich am Freud-Institut zur Analytikerin weiterbildete.
Dass sich an der Universität in Zürich wie an vielen weiteren Universitäten im Fach Psychologie die Verhaltenstherapie derart durchgesetzt habe, passe in den neoliberal geprägten Zeitgeist, sagt Richter. Schliesslich gehe es in der Verhaltenstherapie primär darum, die psychische Befindlichkeit eines Menschen in kurzer Zeit verbessern zu können – was dem verbreiteten Wunsch nach möglichst effizienter Selbstoptimierung entgegenkomme. «Bei der Psychoanalyse geht es um mehr: darum, ein tieferes Verständnis für unbewusste Zusammenhänge zu gewinnen.» Sie verweist auf internationale Metastudien, die der Psychoanalyse eine umso höhere Nachhaltigkeit attestieren. «Wie richtig Freud in vielem lag, zeigte sich kürzlich an einem Symposium, das die SGPsa mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich durchführte: Da ging es auch um neurowissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie sich Erlebnisse in der Psyche einschreiben oder Traumatisierungen über mehrere Generationen weitergegeben werden.»
Wie weiter?
Im PSZ ist man gerade mit anderen Fragen beschäftigt. Thomas Willi, der als Mitglied der Seminarleitung durch die leeren Räume an der Quellenstrasse führt, spricht aus, was schon länger bekannt ist: «Aktuell findet hier keine Weiterbildung statt.»
Eigentlich wollte sich der Politologe, der derzeit Psychologie an der Uni studiert, hier zum psychoanalytischen Psychotherapeuten weiterbilden. Dann aber wurde dem PSZ vor einem Jahr vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) die dafür nötige Akkreditierung entzogen (siehe WOZ Nr. 17/24). Ausgerechnet dieser angesichts ihrer aussergewöhnlichen Geschichte fast schon historischen Ausbildungsstätte, wo Hunderte ihre psychoanalytische Ausbildung durchlaufen haben, darunter nicht wenige, die sich auch als Autor:innen wissenschaftlicher Texte einen Namen gemacht haben? Warum gerade dem PSZ? Liegt es an seiner institutionskritischen Tradition, die sich gegen allzu starke Verschulung, autoritäre Strukturen und staatliche Einmischung wehrt?
Willi winkt ab. «Klar, wir könnten uns jetzt zurücklehnen und sagen: Wir sind halt zu subversiv.» Doch die Ablehnung habe andere Gründe: «Das System einer von Freiwilligenarbeit getragenen Strukturlosigkeit ist an seine Grenzen gestossen.» So habe man es nicht geschafft, das Studienprogramm so weit zu formalisieren, wie es das BAG neuerdings verlangt. Bis dahin war es am PSZ Usus, angehenden Analytiker:innen eine individuelle Zusammenstellung von Kursen zu ermöglichen.
Ist also das gefürchtete «Damoklesschwert» herabgesaust? Droht sich damit ein grosses Kapitel in der Zürcher Geschichte der freudianischen Psychoanalyse zu schliessen – und ein Freiraum verloren zu gehen, in dem sich die psychoanalytische Arbeit immer auch mit einem kritischen Blick auf die Gesellschaft verband? Kommt es zu einer weiteren Spaltung? Oder ist alles gar nicht so dramatisch?
Willi ist zuversichtlich. Zwar gebe es in der Teilnehmer:innenversammlung eine «kleine, aber laute» Minderheit, die befürchte, mit einer Anpassung an die Kriterien des BAG würde das PSZ seine Philosophie verraten und die geistige Unabhängigkeit verlieren. Gestützt auf einen Mehrheitsentscheid, habe sich im letzten Sommer aber eine Arbeitsgruppe gebildet, um in Zürich, der Stadt, die Freud einst zur Welthauptstadt der Psychoanalyse machen wollte, möglichst bald wieder eine staatlich anerkannte Weiterbildung anbieten zu können.
